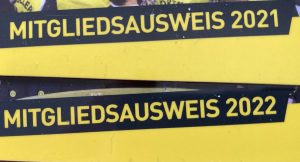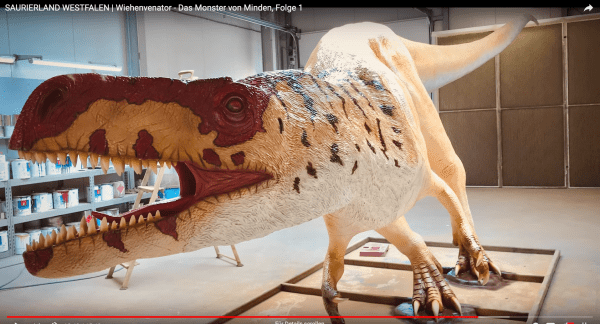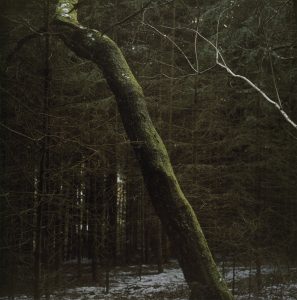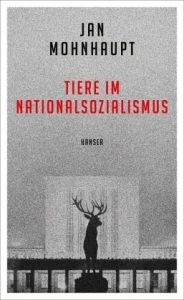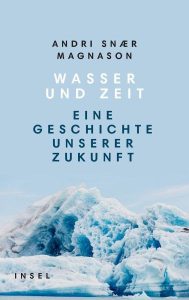Bundestreffen in Dortmund: Was Tierärzte regulieren wollen

Florianturm, Zeche, Dortmunder U und Reinoldikirche als Dortmunder Wahrzeichen – auf Unterlagen der Bundestierärztekammer.
Quizfrage: Wie wird das Deutsche Tierärzteblatt in Fachkreisen liebevoll genannt? Nun, die Lösung lautet: „Grüner Heinrich“. Wenn Gottfried Keller das geahnt hätte… Derlei – für die Allgemeinheit – unnützes Wissen nennt man heute wohl Fun Fact.
Scherz beiseite. Warum mich eine Einladung zur Pressekonferenz (PK) der Bundestierärztekammer ereilt hat, weiß ich wirklich nicht. Noch nie habe ich über dieses Fachgebiet geschrieben. Immerhin findet jetzt der 30. Deutsche Tierärztetag hier in Dortmund statt. Also habe ich mich mal (online) zur PK bemüht und wage es, ziemlich fachfremd zu berichten.
Ich habe ja so gut wie keine Ahnung vom tierärztlichen Metier (außer ein paar bleibenden Eindrücken, wenn wir mit unserem Kater die Tierarztpraxis aufsuchen mussten), dafür haben viele Tierärzte aber auch kaum Ahnung von Dortmund, schmücken sie doch ihre Tagungsunterlagen u. a. mit einer Zechen-Silhouette. Der letzte Schacht in dieser Stadt wurde 1987 geschlossen. Ich übertreibe mal leicht: Wir glauben ja auch nicht, dass Tierärzte sich immer noch vorrangig mit Mammuts und Sauriern befassen.
Nun aber wirklich zur Sache. „Tierschutz im tierärztlichen Alltag“ lautet das zentrale Thema des Bundestreffens im Kongresszentrum der Westfalenhallen. Vier Fachleute berichteten in der Pressekonferenz aus den Arbeitsgruppen. Da ging es um Tierschutz im Pferdesport, in der Kleintierpraxis, bei Behörden und in der Nutztierhaltung – unter besonderer Berücksichtigung der „kleinen Wiederkäuer“ (Schafe und Ziegen).
Da wurden vor allem (weit überwiegend berechtigte) Forderungen gestellt, die jedoch insgesamt einen Wust von Regelungen und wuchernde Bürokratie nach sich ziehen könnten, abgesehen vom wachsenden Personalbedarf und Kostensteigerungen. Nur mal einige Beispiele, der Einfachheit halber ungegendert:
- Es sollten möglichst alle Heimtierhalter auf Eignung geprüft werden.
- Pferdehalterinnen und Pferdehalter sollen ihre Sachkunde zertifizieren lassen.
- Bei allen Reitveranstaltungen sollte mindestens ein Tierarzt dauerhaft anwesend und mit weit reichenden Befugnissen ausgestattet sein.
- Alle Ausrüstungs-Gegenstände in Pferdesport und sonstiger Pferdehaltung sollen auf Tauglichkeit überprüft werden – ungefähr wie Autos beim TÜV.
- Hundetrainer sollen u. a. durch Tierärzte ausgebildet werden.
- Angehende Juristen sollen in ihrem Studium mehr zum Tierschutzrecht lernen.
- Bestimmte Tiere („Defektzuchten“, Qualzuchten) sollen z. B. auch in Werbung und Mode strikt verboten werden.
- Ein europaweites Register für Hunde und Katzen muss eingerichtet werden.
- Tierärzte sollen in Ausübung ihrer Tätigkeit bei etwaigen Konflikten geschützt werden, darin attackierten Rettungskräften vergleichbar.
- Es fehlt eine „Heimtierverordnung“.
- Es fehlt eine zentrale Tiergesundheits-Datenbank.
- Es fehlt eine Datenbank zu Tierhalte-Verboten.
- Tierärztliche Ämter brauchen mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen.
- Es gibt zu viele Einschränkungen bei medikamentösen Behandlungen von Tieren.
- Viele Regelungen müssen bundesweit vereinheitlicht werden.
Und so weiter. Richtig „viel Holz“. Dazu hieß es auf dem Podium: „Wer nicht fordert, bekommt auch nichts.“ Schon richtig. Wie soll es sonst gehen? Aber in der Summe wirkte es denn doch ein wenig begehrlich – wie halt bei allen Interessenverbänden.
Was außerdem auffiel: Es war eine Pressekonferenz, doch mit Fragen und Statements meldeten sich praktisch ausschließlich Kongressteilnehmer, also tierärztliche Fachleute zu Wort. Am Ende war ich vielleicht der einzige Medienvertreter, der eine Frage gestellt hat. Das wäre mir unangenehm. Soll man daraus etwa schließen, dass die Standesorganisation der Veterinäre im eigenen Saft schmort? Oder zeugt es eben von besonderem, manchmal geradezu hitzigem Engagement? Oder mangelt es den Medien schlichtweg an Interesse?








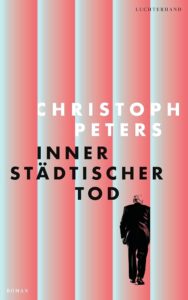
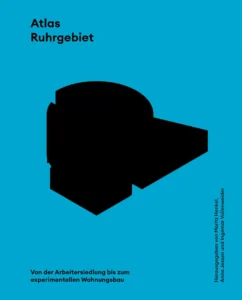
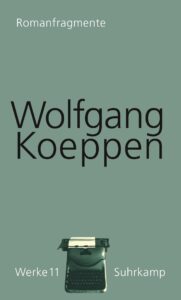
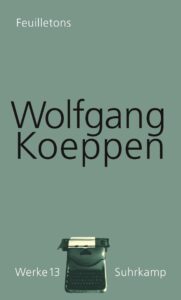
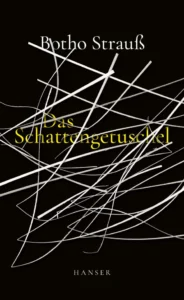













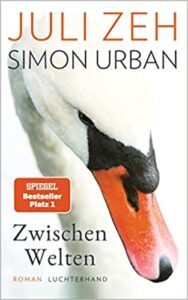




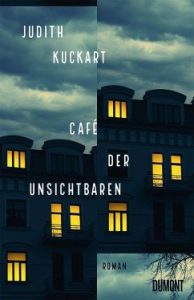





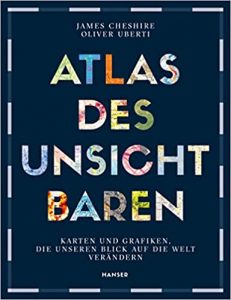
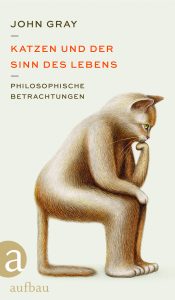






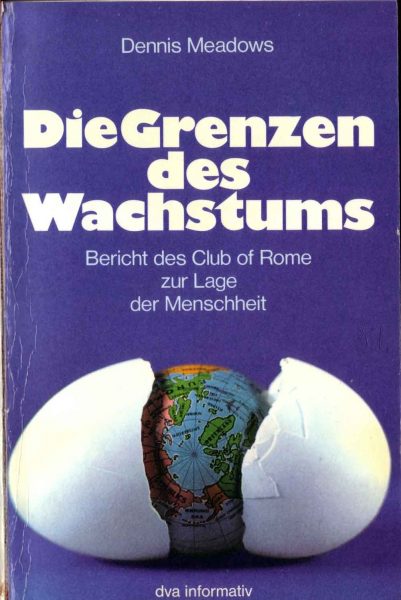 Und doch hat dieses
Und doch hat dieses