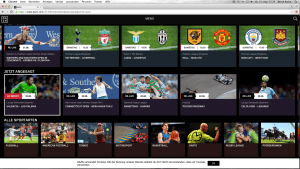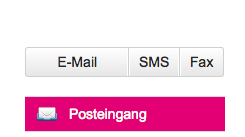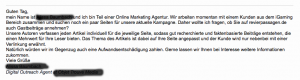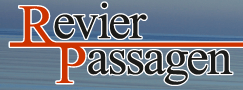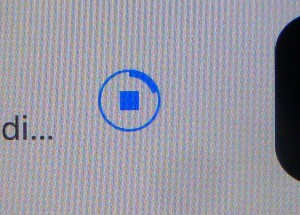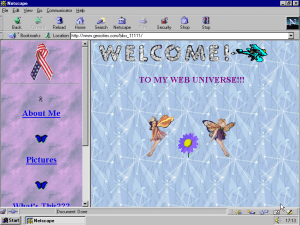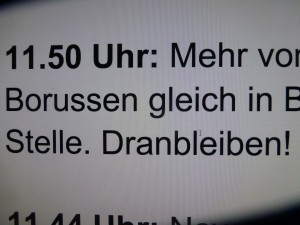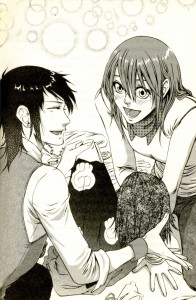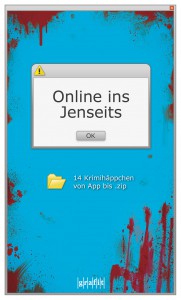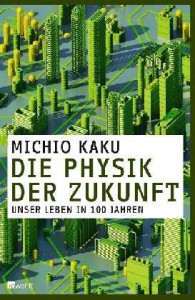Wie und nach welchen Prinzipien soll das Internet der Zukunft gestaltet werden? Unser Gastautor Michael-Walter Erdmann, Künstler und Publizist aus Essen, hat dazu einen grundlegenden Text geschrieben:
̈Wäre das menschliche Auge nicht sonnengleich, es könnte die Sonne nicht sehen. Wenn das menschliche Gehirn kein Computer wäre, könnte es keine Computer bauen. Die Erfindung des Computers ist ein zwanghafter, zwangsläufiger Akt der Auto-Mimesis. Das Internet ist das bislang größte mimetische Projekt des Menschen; digitale Höhlenmalerei.
Mimesis ist nicht nur ein auf Erkenntnis abzielender Kunstvorgang, jedenfalls kein auf Kunst begrenzter Vorgang: Mimesis ist ein biologisch-geistiger Reflex, ein Grundprinzip der Evolution. Zwei, drei Dinge, die man ganz generell zu „Digitalisierung“ sagen muß. Die Digitalisierung krempelt die gesamte Kultur der menschlichen Spezies um. Kein Bereich des menschlichen Lebens bleibt davon unberührt: Ökonomie, Politik, Gesellschaft, Privatleben, der Öffentliche Raum, Ästhetik, Kunst und Kommunikation. Es wird nichts mehr geben, kein Merkmal und keinen Raum und keine Äußerungsform menschlicher Existenz als Species und intelligibler Zivilisation, der von diesem Prozeß nicht erfaßt und prinzipiell umgestellt, umgebaut, in grundlegender Weise strukturell verändert wird.

Digitale Weltmächte dicht an dicht: die Logos von Google, Amazon und Facebook auf einem Apple-Bildschirm. (Foto/Screenshot: Bernd Berke)
Die digitale Revolution ist die am schnellsten wachsende Infrastruktur seit Menschengedenken. Dieser Prozeß ist unumkehrbar, und dieser Prozeß ist unabsehbar, und er verläuft in einer exponentiellen Wachstumskurve. Wir stehen am unteren Ende dieser Kurve.
Die Digitalisierung ist eine neue, ist die aktuelle Periode der menschlichen Evolution. Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der Digitalisierung.
Es gibt 3 Gesetze der Digitalität:
Simultaneität
Ubiquität
Konvergenz
Alle drei Werte tendieren zum Absoluten, akzeptieren keine Endlichkeit, keine Begrenzung. Ein digitaler Content ist prinzipiell überall verfügbar. Das heißt: überall, wo es menschliche Zivilisation und digitale Technik gibt, also so gut wie überall auf diesem Planeten und außerdem außerhalb dieses Planeten überall dort, wo Menschen digitale Technik hinschicken; also auch in Räumen und an Orten, wo keine Menschen sind! Dieser content ist überall gleichzeitig präsent, und Gleichzeitigkeit ist immer Zeichen für und Anzeichen von absoluter, sich selbst absolut setzender Macht.
Herrschaftsanspruch und strukturelle Gewalt
Simultaneität ist Herrschaftsanspruch. Ubiquität und Simultaneität gepaart symbolisieren und repräsentieren eine große materielle Machtfülle und strukturelle Gewalt. Und die Urheber solcher Gewalt wissen um ihre Macht. Um das an einem historisch frühen und vergleichsweise simplen Beispiel zu verdeutlichen, erinnere ich an die erste internationale Währung der Menschheitsgeschichte, an die Standard-Silbermünze, die Alexander der Große in seinem Imperium prägen ließ. Trotz eines gewissen Variantenreichtums legte er großen Wert auf unmißverständliche Wiedererkennbarkeit seines Konterfeis, ikonographischer Ausweis der Omnipräsenz, der Militanz und der wirtschaftlichen Potenz seiner Herrschaft.
Konvergenz bedeutet in diesem Zusammenhang das tendenzielle und progressive Konvergieren vieler unterschiedlicher Medien: Einem digitalisierten Content ist es egal, ob er auf einem großen Screen erscheint, auf einem normalen Computer, einem Tablet, einem Smartphone oder einer Uhr. Er kann an jedem beliebigen Ort als Fernsehbeitrag, CD/DVD/Diskette, als Zeitungsartikel, Buch oder Plakat erscheinen; kann sich also auch wieder in rein analoge oder gemischte (analog-digitale) Medien zurück verwandeln.
Um auch die Grenzbereiche des Analogen zu erwähnen: Ein optischer Content kann als Projektion erscheinen, ein akustischer Content als reines Schallereignis. Content switcht zwischen analogen und digitalen, materiellen und immateriellen Welten und ist in diesen Welten (also an verschiedenen Orten) inclusive der Zwischenwelten gleichzeitig. Darin ähnelt er dem Verhalten von Teilchen im Quantenbereich.
Im Prinzip funktioniert also jegliche Digitalität nach diesen 3 Grundprinzipien, und um sie philosophisch zu fassen, bedarf es keines weiteren Prinzips. Der Rest sind Akzidentien und Anthropologie: Sozialverhalten, Biologie, Evolution. Kein Konzern hat diese 3 Prinzipien besser, umfassender und konsequenter in Produktstrategien und Konnektivität, in Image und Produktprestige umgesetzt als APPLE.
Verlust an Kulturtechniken
Die Digitalisierung sorgt in vielen Bereichen für einen Verlust an Kulturtechniken, kulturellen und zivilisatorischen Standards, für deren Entwicklung die Menschheit Jahrtausende gebraucht hat. Europa war an der Entwicklung dieser Techniken und Standards maßgeblich beteiligt, verteidigt diese aber nicht. Beispiele: Das Navigationsgerät verdrängt die Kunst des Kartenlesens. „Whatsapp“ ist der Ruin der Rechtschreibung, des Briefeschreibens, der Intimität und der Vertraulichkeit; zumindest für ein, zwei, drei Generationen.

Berühren heißt noch lange nicht begreifen: Bildschirm eines so genannten Smartphones. (Foto: Bernd Berke)
Das Gefährliche an der gefälligen „usability“ von digitalen Endgeräten ist die enorme Leichtigkeit der Prozeduren, sind die vielen Automatismen, das Leicht-Fertige. Digitalisierung ist anthropologisch gesehen tendenziell regressiv. Sie erleichtert die Befriedigung atavistischer Instinkthandlungen wie jagen, sammeln, Beute machen; alles vom Sofa aus, jederzeit, an jedem Ort, mühelos.
Die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist gekoppelt an die des aufrechten Gangs, die gleichzeitige Evokation von Sprache und dies beides wiederum an die Evolution der menschlichen Hand. „Begreifen“ als Weltaneignen ist immer ein Doppeltes: Das reale Tun, die Mechanik der Hand, das Anfassen und die Verarbeitung der so zustande kommenden Objektwelt als innere Landkarte auf der Metaebene/Datenverarbeitung des Gehirns.
Bei digitalen Geräten ist der Kontakt des Menschen mit dem Objekt auf ein paar Quadratmillimeter Fingerkuppe reduziert; das ist kein „Begreifen“ mehr. Trotzdem verfügen wir mittels dieser Geräte über prinzipiell unbegrenzte Macht: Macht über Menschen, Geld, Dinge, Prozeduren, Sprache. Das ist verführerisch, das schmeichelt unserer kindlichen Omnipotenz, unserem Narzißmus; es ist regressiv, und wir geben dem allzugern nach. Je jünger wir sind, desto gefährdeter sind wir. Wir brauchen eine europäische Ethik des Digitalen. Der Umgang mit digitalen Geräten muß normativ gelenkt und gelernt werden und gehört in ein Unterrichtsfach und an die Universitäten.
Wo bleibt der Einspruch im Sinne der Aufklärung?
Das alles sind reale Gefahren, die durchaus auf ein kulturelles und zivilisatorisches Verblassen der menschlichen Spezies hindeuten. Und es sind reale Gefahren, weil wir Europäer nichts unternehmen, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Digitalisierung ist nicht aufhaltbar und sie ist im Großen + Ganzen unumkehrbar. Aber man kann sie gestalten, einiges kann + sollte man sogar zurücknehmen.
Es entspricht europäischer, aufgeklärter Vernunft, nicht alles zu tun, was man – technisch gesehen – kann. Im Moment versäumen wir den Einspruch aufklärerischer Vernunft, überlassen die Entwicklung von Algorithmen und damit die kulturelle Prägung von Alltagsprozeduren/Kommunikation/ Marktverhalten etc. den Amerikanern und die Produktion von Geräten den Asiaten.
Es entspricht standardisiertem amerikanischem Denken und einem anthropologisch, kulturell naiven Verständnis der techne, zu sagen: „If it’s makeable, we make it!“ Das ist falsch; das ist auf lange Sicht sogar unökonomisch, weil es aufgrund seiner Priorität (technische Machbarkeit) die Grundlagen von Ökonomie tendenziell zerstört: die Balance von Mensch und Ressourcen. Dieses Denken hängt mit der spezifisch amerikanischen Raumerfahrung zusammen, und die hypostasiert einen prinzipiell unendlichen Raum für Bewegung, Planung und Existenzausdehnung. Dieser Raum ist sowohl real wie auch – im amerikanischen Protestantismus – theologisch aufgehoben und existenzbettend.
Die Sorge um das einzelne Subjekt
Der europäische Begriff von „Ökonomie“ beginnt auf begrenztem Raum beim „oikos“, dem einzelnen Haus und seinen Bewohnern und bei einem prozessualen, dialogischen, dynamischen Ausgleich zwischen Individuum, oikos und der polis als der zusammengehörenden Vielzahl der Häuser; europäisches Denken hebt an mit dem Begriff der Differenz, seine Sorge gilt dem Einzelnen, dem Subjekt: Dem großen Ganzen der Polis geht es gut, wenn es dem Einzelnen in seinem Haus gut geht und umgekehrt.
Diese einfachen existentiellen, komplementären Prinzipien bilden den Kern europäischer Identität und des großen, genuin europäischen Projekts AUFKLÄRUNG, aus ihnen resultieren die regulativen ethischen Werte (Freiheit, Solidarität, Gleichheit, Toleranz usw.) für die man Europa weltweit respektiert, woran Millionen von Menschen in anderen Erdteilen sich orientieren, wenn sie gegen staatliche Willkür, Despotismus, religiöse Intoleranz und Korruption kämpfen.
Diese Sorge ums begrenzt Individuelle, das sein Selbst-Bewußtsein und seine Identität geradezu daraus gewinnt, daß es sich den Verführungen der Entgrenzung klug und verantwortungsvoll verweigert, ist – verkürzt gesprochen – den Algorithmen von KINDLE, AMAZON, FACEBOOK, GOOGLE, WHATSAPP & Co. fremd. Diese Algorithmen zielen auf grenzenlosen Konsum, grenzenlose Kommunikation und grenzenlose Kontrolle und Verfügung bei gleichzeitig grenzenloser Mobilität und Ubiquität.
Rückbesinnung auf europäische Werte
Deswegen plädiere ich für die Rückbesinnung auf die zentralen Werte und Normen europäischen Denkens und für die „Übersetzung“, sozusagen für die „Migration“ europäischer Kategorien in die Sprache und Prozeduren der Digitalität. Das Zeitalter der Digitalität hat gerade erst begonnen, es ist keineswegs zu spät, um mit dieser Aufgabe der Europäisierung der digitalen Revolution zu beginnen.
Digitalität ist eine Technik. Als techne ist sie – so lehrt uns europäisches Denken und so kriegt man die Sache vielleicht auch in den Griff – dem Menschen, seinen Zielsetzungen, seinen Absichten und Zwecken untertan. Zwar ist das leichter gesagt als getan; aber es ist so. Es ist nicht das erste Mal, daß die Geister, die einer neuen Technik innewohnen, sich über den Menschen erheben, ihn verführen oder ihm Angst machen und ihn beherrschen. Es war immer wieder schwierig und manchmal auch langwierig, solche Verkehrungen vom Kopf auf die Füße zu stellen; und es beginnt immer mit diesen zwei Wörtern: Sapere aude!
Ceterum censo:
Schaffen wir eine Digitalisierung mit europäischem Antlitz! Nach meinem Dafürhalten gehört diese Aufgabe ins Ruhrgebiet. Es gibt hier eine Menge Menschen + Institutionen, die an dieser Aufgabe partizipieren könnten und es sicher auch gern täten.