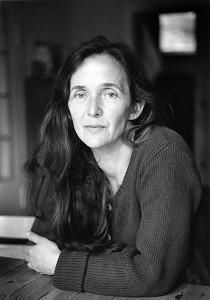Politisch korrekte Straßennamen oder die Sucht nach Verdrängen
In Münster fällt es vielen aus heiterem Himmel ein: Hindenburgplatz, geht doch nicht, der war ja Steigbügelhalter des Unaussprechlichen. Oder: Agnes Miegel, kann man doch in einer gescheiten Kulturstadt keine Straße nach benennen, die reimte doch nicht nur im Blut-und-Boden-Wahn, sondern glühte gar nicht still und auch nicht heimlich den Gröfaz an. Eine Kommission wird ins Leben gerufen und forstet im Münsteraner Straßenschilderwald herum, ob denn noch mehr unwerte Namen aus ihm zu tilgen seien.
Damit wir uns nicht missverstehen. Ich halte keinen Platz für geeignet, den Namen Hindenburgs zu tragen. Ich bin ebenso wenig der Ansicht, dass die Droste des Ostens (sorry Annette von …, das hast Du nicht verdient, aber so nannte man die Miegel gern) es verdient hätte, dauerhaftend in unserem Gedächtnis zu verweilen (fand selbst ihr nicht gar so verdächtiges Wortgedudel schon als Schüler erbärmlich). Aber da entpuppen sich Gutmeinende wieder einmal als Vorantreiber des Verdrängens, Vergessens und Verächtens. Getreu dem Motto: Was wir nicht mehr sehen, lesen, wahrnehmen können, das hat dann auch wohl so nicht stattgefunden.

Wollte man ganz konsequent sein, dürfte man auch keine Straße nach dem "Franzosenfresser" Ernst Moritz Arndt benennen. (Foto: Bernd Berke)
Nun, dann sollten die Hüterinnen und Hüter eines politisch korrekten Straßenraumes aber auch richtig konsequent sein. „Jahnstraße“, ganz schnell weg damit. Denn der Turnvater (ich kann mich noch bestens an verehrende Augen meiner Lehrer erinnern) gab schon lange vor der Zeit des Unaussprechlichen üblen Antisemitismus von sich. Lützowstraße, auch fort damit, kriegerischer Unrat – oder nicht, nannte sich damals doch Befreiungskriege. Sauerbruch sollte auch kein Pate sein. Der hat dem verletzten Putschisten – dem Unaussprechlichen – in München mal die Schulter behandelt. Aber auch mal einen Sozialdemokraten kuriert. Aber auch den Mörder von Kurt Eisner zusammengeflickt. Und flugs ward der Professor, als die braunen Machtverhältnisse ganz klar waren, ein Aufrufer zum hippokratischen Glaubensbekenntnis für den unaussprechlichen Adolf Hitler, dessen Namen völlig zu Recht kein Straßenschild mehr tragen darf.
Vermutlich wäre eine Schwarz(braun)Liste aufzustellen, die beliebig zu verlängern ist. Ich will es aber abkürzen. Vielleicht entspricht es ein wenig der germanischen Mentalität, einerseits unbeliebte historische Zeiträume aus dem öffentlichen Bild zu tilgen, gleichzeitig deren Vertreter aber in lebender Form – sofern von Nutzen – weiter im öffentlichen Raum agieren zu lassen. Die Nachkriegsjahre belegen das sehr deutlich. (Ähnlich ging es im nachhinein betrachtet zu, als die ehemalige DDR der nach wie vor BRD angeschlossen wurde.) Ein Vorschlag, der möglicherweise allen Verehrern des Siegers von Tannenberg ebenso gerecht wird wie den ebenso zahlreichen Kritikern: Nennen wir nicht nur Straßen, sondern auch Kasernen zukünftig ausschließlich nach unverfänglichen Paten. Blumen zum Beispiel. Ach nein, das wäre ja auch öde. Und ließe es zu, dass wirklich werte Zeitgenossen auch in Vergessenheit geraten könnten. Also plädiere ich für echte und gern auch ächtende Konsequenz, sofern das geht und wirklich gewollt wird.