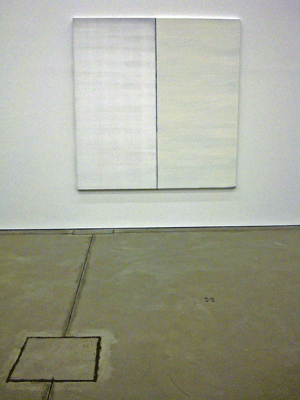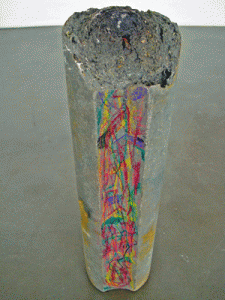Das Sexmonster greift an
Ob eine Dreiecksbeziehung mit Leiche, Blutorgien oder das kampfbereite Hirn von Hitler – der als Trash-Papst gefeierte Arthouse-Horrorfilmregisseur Jörg Buttgereit hat eine Vorliebe für Themen, die unsere Gesellschaft lieber verdrängen würde. Der Dortmunder Schauspieldirektor Kay Voges hat diesen Grenzgänger engagiert, mit dem Double-Feature „Green Frankenstein“ und „Sexmonster“ die Studio-Saison zu eröffnen. Mut, der sich gelohnt hat.
Jörg Buttgereit hat eigentlich Unmögliches möglich gemacht: Trash-Kultur im Theater, Film auf der Bühne, japanischer Monsterfilm ohne Monster, schmieriges Zitat der Sexploitation-Filme aus den 70ern ohne Nacktheit – der Regisseur bricht in jeder Hinsicht mit Erwartungen und Konventionen. Und hat stattdessen ein Konzept entwickelt, das so folgerichtig wie unterhaltsam ist, dass es sich auf weitere Theaterabende übertragen ließe:
Ausgangspunkt für die beiden Stücke „Green Frankenstein“ und „Sexmonster“ sind von Buttgereit geschriebene Hörspiele. Die Idee des „Kopfkinos“ setzt er konsequent um, indem er die Schauspieler in einem schmuddeligen Bahnhofskino agieren lässt, ständig wechselnd zwischen Zuschauer und Figur, mit Mikrofonen in der Hand und Text, der auf der Leinwand mitläuft.
So spiegelt Buttgereit nicht nur Zuschauer mit Zuschauern. Er sorgt auch dafür, dass das, was wir sehen, hauptsächlich aus uns selbst kommt.
Und das ist bei den verhandelten Themen eine starke Grundsituation: „Green Frankenstein“ erzählt von einem wütenden Monster in Hiroshima, das die Menschen vernichten will, weil sie das ökologische Gleichgewicht gefährden. „Sexmonster“ entführt in das zwielichtige New York, wo der Außenseiter Adam seine Chance wittert, als ihm der riesige Penis seines verstorbenen Freundes transplantiert wird. Doch anstelle eines erfolgreichen Liebhabers wird er zum triebgesteuerten Sexmonster.
Köstlich, wie die Schauspieler – Sebastian Graf, Bettina Lieder, Uwe Schmieder und Annika Meier, Christoph Jöde– sich in diese Abenteuer stürzen, die schrägsten mimischen Varianten testend, musikalisch brillierend, zur Beatbox mutierend, jede Situationskomik auskostend. Der Clou ist die Live-Performance des Geräuschemachers Dieter Hebben: Als er bei der Penistransplantation eine Porreestange ansägt, winden sich die männlichen Zuschauer.
So schräg, witzig, ungewöhnlich ist dieses dennoch cineastische Erlebnis, dass sich das Publikum schier ausschüttet vor Lachen. Unter all dem Trash und der Komik aber versteckt Buttgereit einen überraschend moralischen Subtext: Der Mensch, der sich gegen die Natur stellt und als Gott aufspielt, ist schließlich ein altes (Film)-Thema.
(Der Artikel stand zuerst in der Westfälischen Rundschau)
Teaserfoto: Birgit Hupfeld