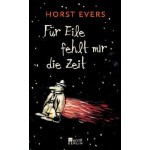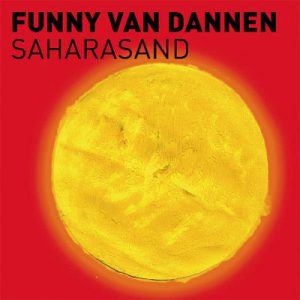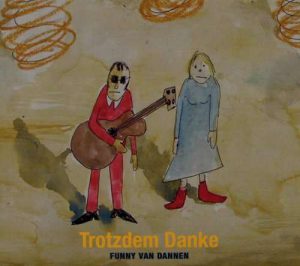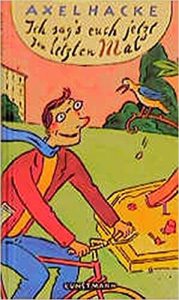Von Bernd Berke
Vielleicht treffen sie sich jetzt dort droben: Wolfgang Amadeus Mozart und Heinrich Heine. Falls ja, dann können der Komponist und der Dichter einander Hochachtung, aber auch wechselseitiges Mitleid bekunden. Allenthalben werden sie rituell gefeiert, weil sich biographische Daten „runden“. Heute vor 150 Jahren starb Heine nach langjährigen Leiden in seiner Pariser „Matratzengruft“.
Wie überaus betrüblich: Einer, der dem göttlich guten Leben im Diesseits derart zugetan war, musste so elendiglich enden. Nur zu verständlich, dass Heine zuletzt allen atheistischen Anwandlungen abschwor und um Gottgläubigkeit rang. Nur ahnungslose Schandmäuler können ihm dies verübeln.
Seine Werke gehören unverbrüchlich zur Weltliteratur. In Frankreich zählen die Bücher von „Henri“ ebenso zum ehernen Bestand wie bei uns – und mancher Japaner oder Russe kann wahrscheinlich das „Loreley“-Gedicht im deutschen Original aufsagen.
Sein Witz war kühn und treffsicher
Das berühmte „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ konnten nicht einmal die Nazis verschweigen. Allerdings schrieben sie die Zeilen einem „unbekannten Dichter“ zu.
Heine war Rheinländer jüdischen Glaubens, als junger Mann ließ er sich allerdings christlich taufen, denn: „Der Taufzettel ist das Entréebillet zur europäischen Kultur.“ Antijüdische Vorurteile gegen Heine steigerten sich schon bei einigen seiner Zeitgenossen zu erschreckenden Hasstiraden. Die üblen Klischees des 19. Jahrhunderts führten letztlich auch zur Bücherverbrennung von 1933.
Der Heißsporn Heine hat sich zu seiner Zeit mit nicht lauteren Mitteln gewehrt: Als der Dichter August Graf von Platen ihn mit antisemitischen Untertönen angriff, machte sich Heine öffentlich über dessen Homosexualität lustig – damals ein ungeheurer Skandal und wohl der schlimmste deutsche Dichterstreit überhaupt.
Nachwirkung zwischen Karl Kraus und Nietzsche
Heines Nachwirkung ist stets eine Streitfrage gewesen. Selbst ein ungemein kluger, doch hitziger Kopf wie Karl Kraus hat Heine als Vorläufer eines unverbindlich plaudernden Stils missverstehen wollen. Kraus-Zitat: „Ohne Heine kein Feuilleton. Das ist die Franzosenkrankheit, die er uns eingeschleppt hat.“ Heine habe „der deutschenSprache so sehr das Mieder gelockert (…), dass heute alle (…) an ihren Brüsten fingern können.“ Friedrich Nietzsche bezog die Gegenposition: „Man wird einmal sagen, dass Heine und ich bei weitem die ersten Artisten der deutschen Sprache gewesen sind …“
Die Vaterstadt Düsseldorf hat sich mit Heine schwer getan. Schier endlos währte das Gezerre darum, ob die Uni seinen Namen tragen sollte 1989 war es so weit. Ehrenbürger ist er bis heute nicht.
Mit Herzblut hat Heine einige der schönsten romantischen Gedichte geschrieben. Doch sein flackernder, treffsicherer Witz und seine oft kühnen Formulierungen (er reimte schon mal „ästhetisch“ auf „Teetisch“) ließen wehe Idyllen und Schauermärchen der Romantik weit, weit hinter sich.
Gemischte Gefühle fürs aufkommende Proletariat
Er hat nicht nur höchst sprach- und formbewusste, sondern aufsässige Texte geschrieben – mit satirischer Stoßrichtung gegen schläfriges Biedermeier, starres Preußentum und aggressiv dumpfen Nationalismus (nationale Einigung ja, aber bitte unter freiheitlichen Vorzeichen). Ach, wüsste man doch, was der Erz-Journalist Heine zum jetzt so akuten Streit um Karikaturen und Pressefreiheit gesagt hätte!
Mit gemischten Gefühlen sah Heine das Proletariat heraufkommen. Er begriff die Notwendigkeit dieser Entwicklung, fürchtete aber auch die Barbarei der neuen Klasse – eine Schreckensvision, die im Realsozialismus grässliche Gestalt annahm. Im Grunde blieb Heine Monarchist, freilich ein aufgeklärtes Königtum, das per Verfassung alle (bürgerlichen) Menschenrechte wahren sollte.
Mit Potentaten und Zensoren in Berlin hatte er ebenso Probleme wie mit kaufmännischen „Pfeffersäcken“ in Hamburg, wo sein reicher Bankiers-Onkel Salomon und sein Verleger Campe lebten – zwei Menschen, mit denen er oft um Geld gestritten hat.
Welch eine Befreiung muss Paris bedeutet haben, damals die konkurrenzlose Weltmetropole mit rauschendem Kultur- und Gesellschaftsleben, an dem Heine ausgiebig teilnahm. Hier traf er prägende Gestalten jener Zeit – von Richard Wagner bis Karl Marx, von Hector Berlioz bis Balzac und George Sand.
„Dicht hinter Hagen ward es Nacht.. .“
Seinen Büchern kann man entnehmen, dass er trotz alledem wehmütig an seiner Heimat gehangen hat. Er hatte „das Vaterland an den Sohlen“ – wären es doch nur befreite Lande gewesen! „Denk ich an Deutschland in der Nacht…“
Der Rheinländer Heine hat die geradlinige westfälische Wesensart sehr geschätzt. In Göttingen sang und trank er mit Studienfreunden aus hiesigen Breiten.
Die Zeilen, die jeden Westfalen rühren, stammen aus der ansonsten eminent politischen Dichtung „Deutschland. Ein Wintermärchen“ und schildern Heines Reise nach Hamburg (1843), die durch Westfalen führte:
„Dicht hinter Hagen ward es Nacht, / Und ich fühlte in den Gedärmen / Ein seltsames Frösteln. Ich konnte mich erst / Zu Unna, im Wirtshaus, erwärmen…/ Den lispelnd westfälischen Akzent / Vernahm ich mit Wollust wieder.“
Und nun kommt’s:
„Ich habe sie Immer so lieb gehabt, / Die lieben, guten Westfalen, / Ein Volk so fest, so sicher, so treu, / Ganz ohne Gleißen und Prahlen (…) / Sie fechten gut, sie trinken gut, / und wenn sie die Hand dir reichen, / Zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie; / Sind sentimentale Eichen.“
Beileibe nicht nur wegen dieser Verse: Der Weltbürger Heine verdient unbedingt auch die westfälische Ehrenbürgerschaft.
___________________________________________________________
LEBENSDATEN
Kaufmannslehre und Romantik
- Heinrich Heine (Bild) wird am 13. Dezember 1797 in Düsseldorf geboren.
- Er erwirbt kein Reifezeugnis, sondern wechselt zur Handelsschule.
- Ab 1815 Kaufmännische Lehrzeit in Frankfurt und Hamburg.
- 1816 Unglückliche Liebe zur Cousine Amalie.
- 1817 Erste Gedichte unter Pseudonym.
- Ab 1819 Jura-Studium in Bonn, Göttingen, Berlin. Auch philosophische Vorlesungen, u. a. bei Hegel.
- 1825 Examen, Promotion, protestantische Taufe.
- 1826 Erster Teil der „Reisebilder“ (u.a. „Die Harzreise“, „Die Nordsee“).
- 1827 „Buch der Lieder“ (zu Lebzeiten 13 Auflagen). Reise nach England.
- 1828Norditalien-Reise
- 1829 Umzug nach Berlin
- 1837 Heine zieht nach Paris, berichtet von dort für deutsche Zeitungen.-•1835 Verbot der Schriften Heines im Dt. Bund.
- 1836 „Die romantische Schule“
- 1840 Streitschrift gegen Ludwig Börne (Folge: Duell mit einem Börne-Fan).
- 1 841 Heirat mit der 18 Jahre jüngeren Mathilde, die er 1834 kennen gelernt hatte. Heine schrieb: „Sie hat einen sehr schwachen Kopf, aber ein ganz vortreffliches Herz.“
- 1843 und 1844 Reisen nach Hamburg.
- 1844 „Deutschland. Ein Wintermärchen“.
- 1847 „Atta Troll“
- 1848 Feb./März: Bürgerliche Revolution in Frankreich und Deutschland. Heine ist ab Mai für den Rest seines Lebens durch Krankheit ans Bett gefesselt („Matratzengruft“).
- 1851 „Romanzero“
- 1854 „Geständnisse“
- 1856 (17. Februar): Heinrich Heine stirbt in Paris.