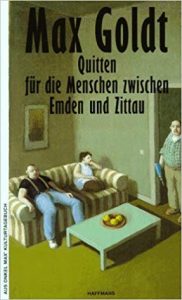Ein Bär mit Verstand: „Pooh’s Corner“, Harry Rowohlts gesammelte Kolumnen
Von Bernd Berke
Es gibt sie – jene höhere Weisheit. die sich hinter trudelndem Unsinn verbirgt. Zu ihren Großmeistern zählt Harry Rowohlt. Das ist einer, der spürbar immer viel, viel mehr weiß, als er hinschreibt. Und eben das verleiht seinen Sätzen einen ganz besonderen Drall.
In seiner Kolumne „Pooh’s Corner – Meinungen eines Bären von geringem Verstand“, hat Rowohlt einen scheinbar nonchalanten, ja gelegentlich regelrecht „besoffenen“ Stil in der Wochenzeitung „Die Zeit“ zur Reife gebracht. Diese sprachlichen Aus- und Abschweifungen liegen jetzt, ergänzt um einige Essays und Filmkritiken, gesammelt vor. Das wurde aber auch mächtig Zeit!
Harry Rowohlt, namentlich erkennbar ein Sproß der berühmten Verleger-Familie, ist ein Querschädel und Originalkopf, der seine kleinen und großen Besessenheiten pflegt: vor allem die Liebe zum Trinker-Paradies Irland und zu dessen größtem Autor neben James Joyce, Flann O’Brien (den Rowohlt kongenial übersetzt hat); sodann sein Kultbuch von Kindheit an, „Pu der Bär“ („Winnie the Pooh“ von A. A. Milne, 1926), das der Kolumne den Titel gab.
Rowohlts Texte sind von schönster Gelassenheit, geschrieben mit feinem Ohr für jene Neben- und Zwischentöne, auf die es ankommt, doch jeder sich aufblähenden Schwerdenkerei abhold. Sie können mit Leichtigkeit hierhin und dorthin schlingern und allerlei Hintersinn am Wegesrand aufsammeln.
Der Fuchs und das Trinkerlied
Herrlich die überraschende Kombinatorik, mit der Rowohlt das Entlegenste zusammenholt und miteinander zünden läßt. Pröbchen gefällig? „Wenn wir zum Beispiel eine Flasche öffnen und zügig einschenken, hören wir—.“ Es folgt ein Notenbild, das sogar stimmt (selber testen!) und das wiederum genau den Anfangstakten von „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ entspricht. Rowohlts souveräne Schlußfolgemng: Das sei also nachweislich kein Jägerlied, sondern ein Trinklied…
Und wie war das noch mit Alzheimer? „Früher, wenn man sich keinen Namen merken konnte, hieß das vergeßlich. Inzwischen heißt das Alzheimer. Und wieder muß man sich einen Namen merken.“ Prägnanter kann man es nicht sagen.
Ähnlich gut wie „Pooh’s Corner“ sind übrigens die Filmkritiken, was sich gerade in der Zusammenschau erweist. Rowohlt schreibt ganz, ganz knappe Rezensionen. Ach, was! Es sind eben gar keine Rezensionen im üblichen Sinne, sondern Plaudereien haarscharf am Inhalt der Filme entlang oder gar daran vorbei. Und trotzdem, o Wunder, trifft er das (Un-)Wesen der jeweiligen Filme bis ins Herz. Das schaffen die meisten mit der zehnfachen Zeilenzahl nicht!
Und wer hat sich schon mal so schön flapsig aus einem Text und vom Leser verabschiedet wie Harry Rowohlt? Zitat: „Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die bis hierher gelesen haben. Ich weiß, was in Ihnen vorgeht. Ich habe es auch satt.“
Harry Rowohlt: „Pooh’s Corner“. Haffmans Verlag, Zürich. 272 Seiten. 28,50 DM.