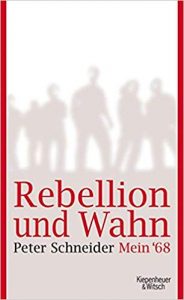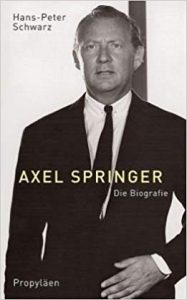Die Kunden-Universität
Die Hochschulen sind voll? Gut so! Im Jahr 12 nach Bologna darf sich der Studierende als Kunde im akademischen Betrieb fühlen. Der tut alles dafür, der Zielgruppe seine Dienstleistung möglichst schmackhaft zu machen. Studieren im Jahr 2011 – eine Collage.
Montag, 10 Uhr. Ursula Gather, Rektorin der Technischen Universität Dortmund, hat ihr professionelles Lachen aufgesetzt. „Gemeinsam sind wir stark“ steht auf dem schwarz-gelben Schal, den sie für die Kamera in die Höhe hält. Auch wenn sie inmitten von Studierenden sitzt: Die Tribüne des örtlichen Fußball-Bundesligisten ist nicht gerade vertrautes Terrain für die Statistik-Professorin.
Kay Voges’ Lachen ist gequält. Auch der Chef des Dortmunder Schauspiels reckt einen Schal in der Höhe, „Schal-la-la-la“ steht darauf. Klick – der Fotograf der örtlichen Presse hat sein Bild im Kasten, Gather und Voges lassen den Schal wieder sinken.
Die Uni-Rektorin in schwarzem Mantel und der Schauspiel-Intendant in Lederjacke, sie sind hier, weil sie eine Mission haben. An diesem kalten Montagvormittag im Fußballstadion wollen sie das gleiche: die frisch Immatrikulierten erreichen, begeistern, für sich einnehmen. Die Studenten sind „Young Potentials“, sie sind ihre Zielgruppe. Kay Voges will sie in seine Theaterabende locken, die neuerdings mit einer Warnung vor Stroboskop-Licht beginnen und „Green Frankenstein & Sexmonster“ heißen. Ganz so viel Action hat Ursula Gather zunächst nicht zu bieten. „Sie sind die Stars von morgen an unserer TU“, ruft die Rektorin den 4000 anwesenden Neulingen zu. Dann sagt der Oberbürgermeister den Neu-Dortmundern Hallo. Es gibt ein Konzert, es gibt etwas zu gewinnen, sogar eine Gebärden-Dolmetscherin ist da. Eine simple Begrüßung der Erstsemester ist es nicht, die die TU da auf die Beine gestellt hat – es ist ein Event, ausgerichtet auf junge Leute, denen man einiges bieten muss, wenn man ihre Aufmerksamkeit will.
Bei David Kraß hat es nicht funktioniert: Er ist der Begrüßung im Stadion fern geblieben. „Ich hab das leider total verpennt“, sagt der 21-Jährige und streicht mit der Hand über seine üppigen Locken, einmal von hinten nach vorn und wieder zurück. Nach einer abgebrochenen Koch-Lehre entschied sich David, Mathe- und Sowi-Lehrer für Gymnasium und Gesamtschule zu werden. David Kraß: Einer von 115.000, die an diesem Montag in NRW ihr Studium beginnen. Und zwar nicht mit einem Event, sondern später am Tag mit der Vorlesung „Einführung in die Soziologie“ im HS 1 der EF 50. Dass sich hinter den Abkürzungen der Hörsaal 1 in der Emil-Figge-Straße 50 verbirgt, wusste David schon, als er zu Hause in Dortmund-Kirchlinde losfuhr, eine Dreiviertelstunde mit dem Bus, einmal umsteigen. Auch den Weg von der Bushaltestelle zu seinem Gebäude kannte er schon, dank der Orientierungsphase. Mehrere Tage lang konnte David alle Fragen loswerden, auf dem Programm stand unter anderem „Spiele, Informationen, Gespräche mit Höhersemestrigen“. Zum Abschluss dann ein Kneipenabend.
Um acht Prozent ist die Zahl der Studienanfänger an der TU Dortmund in diesem Wintersemester gestiegen, 4600 junge Leute haben sich fürs erste Semester neu eingeschrieben. Das ist vergleichweise wenig: In ganz NRW stieg die Zahl der Neu-Studenten um 18 Prozent. Das liegt vor allem an der Abschaffung der Wehrpflicht: Zusätzlich zu den jungen Männern, die nun direkt von der Schule zu Uni gehen, kommen noch jene, die gerade ihren Wehr- oder Zivildienst absolviert haben. Außerdem gab es in Niedersachsen und Bayern durch die Verkürzung der Schulzeit von 13 auf 12 Jahre gerade doppelt so große Abiturjahrgänge. Dieser Umstand hat sich jedoch zumindest in Dortmund nicht ausgewirkt – nur wenige Dortmunder Erstsemester kommen aus Bayern oder Niedersachsen.
Zahlende Kunden im akademischen Betrieb sind sie zwar nicht mehr, die Studierenden – die Studiengebühren in NRW sind seit diesem Wintersemester abgeschafft. Dennoch wird die Leistung einer Hochschule, und damit auch ihre Finanzierung, daran bemessen, wie erfolgreich sie den Arbeitsmarkt bedient. Je mehr Studierende sie mit Bachelor, Master oder dem Doktor-Titel entlässt, desto mehr Geld gibt es vom Land.
Walter Grünzweig kann diesen Umstand weitaus böser formulieren. Dann klingt es so: „Wir erhalten unser Geld vor allem dafür, dass wir möglichst viele Studierende möglichst schnell durch stromlinienförmige Curricula in Designerstudiengängen führen, die durch Verlaufspläne schon vorab auf ihre Gleitfähigkeit geprüft wurden“, sagt der Professor für amerikanische Literatur und Kultur an der TU Dortmund. Bis zum vergangenen Jahr war er als Mitglied des Rektorats für das Studium und die Qualität der Lehre verantwortlich. Grünzweig gilt als scharfer Kritiker des Bologna-Prozesses, der den deutschen Hochschulen seit Anfang des Jahrtausends das System angeblich europaweit vergleichbarer Bachelor- und Master-Abschlüsse und standardisierter Lehrveranstaltungen beschert hat. Grünzweig sagt öffentlich Sätze wie: „Kreativität entsteht durch radikale Interdisziplinarität“, oder: „Die Zeit meines Studiums war entscheidend länger als die Regelstudienzeit und erlaubte mir den Luxus von Lektüre und Reflexion außerhalb von Credits und Workloads.“ In Grünzweigs Seminaren – Vorlesungen hält er sowieso für überflüssig – beschäftigen sich die Studierenden jeweils auch damit, woran ihr Professor gerade forscht, ob das nun Walt Whitman oder „Bildung im transatlantischen Kontext“ ist. Mit Erfolg: Grünzweig erhielt im vergangenen Jahr den Ars legendi-Preis für exzellente Hochschullehre der Hochschulrektorenkonferenz. „Ich finde es falsch, jedes Semester die gleichen Seminare anzubieten“, sagt Grünzweig.
Sein Nachfolger im Rektorat, Metin Tolan, tut genau das. Die Vorlesungen des Professors für Experimentelle Physik heißen „Experimentelle Physik 1“ oder „Physik 3“. Dabei ist auch Tolan ein ausgezeichneter Lehrender: In seine als äußerst unterhaltsam geltenden Vorlesungen streut er gerne Filme ein, 2010 wurde er von einer bundesweiten Studentenzeitschrift zum „Professor des Jahres“ gekürt. Auf seiner Veröffentlichungsliste finden sich Titel wie „James Bond und die Physik“ oder der „Physik des Fußballspiels“. „Bologna hat mehr Stringenz ins Studium gebracht, sagt er, „war es denn wirklich besser, dass man früher zehn Semester lang studieren konnte, ohne einmal eine Prüfung machen zu müssen?“
Der Physiker und der Amerikanist stehen für unterschiedliche Auffassungen davon, was universitäre Lehre heute leisten müsste. In Grünzweig und Tolan stehen sich das Humboldtsche Bildungsideal und die Vorstellung von einer Hochschule als Berufsvorbereitung gegenüber. Sollte die Universität den Studenten als intellektuellen Dialogpartner ernst nehmen, wie Grünzweig es fordert – oder sollte sie ihn in den Mittelpunkt stellen, sich nach seinen Bedürfnissen ausrichten? Die Hochschulen haben die Antwort darauf längst selbst gegeben. „Der Student steht bei uns absolut im Fokus“, schwärmt Tolan, „für den Service, der heute geboten wird, hätte ich früher 500 Euro freiwillig bezahlt.“
Was mit „Service“ gemeint ist, lässt sich erahnen, wenn man David beim Studenplanbasteln beobachtet – oder vielmehr beim Stundenplan-Auswerfen. Denn wenn sich David im Onlinesystem der Uni einloggt, ist der Plan schon fast fertig. Das System hat seine Pflichtveranstaltungen bereits druckfertig eingefügt. Klickt David dann auf seine Vorlesung „Didaktik der Zahlen und Elementaren Algebra“, hat er sofort alles im Blick: Ort und Zeit, Telefonnummer und E-Mail des Dozenten, Literatur. Er kann sogar sehen, ob die Veranstaltung in jedem Semester oder nur einmal im Jahr angeboten wird. Und er kann sich den Idealverlauf eines Durchschnittsstudiums anschauen, um es genau so nachzustudieren.
David selbst nutzt das System allerdings kaum. „Ich habe mir mit Kollegen selbst ein Programm geschrieben, das wir übersichtlicher finden“, sagt er. Außerdem hat er sich seinen Stundenplan mit 24 Semesterwochenstunden etwas voller gepackt als Otto Musterstudent: „Rausschmeißen kann ich später immer noch“. Den Mittwoch hat er sich frei gehalten, um den Vorlesungsstoff zu Hause nachzuarbeiten. „Eine Vorlesung braucht zwei Stunden Nachbereitung“, sagt David. Das hat er in der Orientierungsphase gelernt. Sein Plan ist es, vor allem am Wochenende nachzuarbeiten. Er will sein Studium in der Regelstudienzeit beenden, sechs Semester bis zum Bachelor, vier bis zum Master of Education. Mit Mathe und Sozialwissenschaften hat er eine gute Kombination gewählt. Die Einstellungsschancen sind bestens, und David ist hoch motiviert. Er freut sich auf Formeln und Aufgaben, die man lösen und abhaken kann, nach harten Monaten bei rüdem Umgangston in der Küche seines Ausbildungsbetriebs.
Freitag, 12 Uhr. Hoch-Zeit in der Hochbahn, die alle paar Minuten zwischen dem Süd- und dem Nord-Campus verkehrt. „Das Seminar war meeega-anspruchsvoll“, klagt eine junge Frau ihrer Kommilitonin, „man musste die Texte wirklich alle lesen! Die hat später danach gefragt!“ Ihre Kollegin schüttelt ungläubig den Kopf. Draußen nieselt es, der Himmel ist grau wie der Beton der Geschossbauten.
David ist um halb sieben aufgestanden, um um 8 Uhr an der Uni zu sein. Er wohnt noch zu Hause. Einen Führerschein hat er nicht, ebensowenig ein Laptop. Damit fällt er fast schon auf. Wer den Blick über die Klapptische einer x-beliebigen Vorlesung schweifen lässt, sieht Laptops in jeder Reihe. Auf vielen Monitoren ahnt man das blaue Logo des sozialen Netzwerks „Facebook“. Dank des kostenlosen W-Lan-Netzes muss kein Student auch nur für die Dauer eines Seminars auf Online-Präsenz verzichten.
In den fünf Tagen als Student hat David schon vieles gelernt: Dass man Vorlesungen, die gegen Mittag enden, am besten fünf Minuten vor Ende verlässt, da sonst die Schlange in der Mensa unerträglich lang wird. Dass man morgens zuerst seine Uni-Mails checken sollte, weil die Dozenten manchmal erst abens schreiben, dass ihre Veranstaltung am nächsten Morgen ausfällt. Dass es für jedes studentische Problem eine Vielzahl an Servicestellen, Beratungseinrichtungen und Webseiten gibt. „Gestern Abend habe ich um sieben Uhr noch eine Mail mit einer Frage losgeschickt und hatte um halb acht schon die Antwort“, sagt David halb verwundert, halb begeistert. Aufs Studium bezogen hat der Neu-Student vor allem eines gelernt: Dass man nicht alles auf Anhieb verstehen muss, was der Professor während der Vorlesung sagt. „Mathe ist schon teilweise echt heftig“, sagt er. Dafür ist ja die Nachbereitung da. Er nutzt nun auch die Zeitfenster zwischen zwei Vorlesungen zum Nachbereiten, zum Beispiel in der Uni-Bibliothek.
Die hat von 7 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts geöffnet, sogar am Wochenende. In dieser Zeit kann man dank entsprechender Automaten auch Bücher ausleihen und zurückgeben. Wer anschließend im Dunkeln zur S-Bahn oder seinem Auto laufen muss, kann sich sogar vom Wachdienst dorthin begleiten lassen. Dennoch ist man in der Bibliothek mit dem eigenen Service noch nicht ganz zufrieden. „Wir würde gerne mehr PC-Plätze und mehr Gruppenarbeitsplätze anbieten, an denen Studenten zusammen lernen und auch reden dürfen“, sagt Sprecherin Iris Hoepfner. In der ersten Woche des Wintersemesters bietet die Zentralbibliothek für die Anfänger zwei Führungen täglich. „Die werden ganz prima angenommen“, sagt Hoepfner erfreut, „im vergangenen Jahr hatten wir nur 120 Interessenten, jetzt sind es etwa doppelt so viele.“ 240 Studierende, das sind gerade mal fünf Prozent aller neu Immatrikulierten.
Wieder ein Montag. Endlich scheint mal die Sonne. Bei dem klaren, kalten Wetter wirkt der Campus plötzlich ganz freundlich. Vor dem Gebäude EF50 glitzert das Regenwasser-Biotop, die Mensa leuchtet in fröhlichem Orange. In der stilvoll mit dunklem Holz ausgestatteten Café-Ecke der Mensa riecht es süßlich nach Karamel-Macchiato. David ist mit seiner Nachbereitung immer noch im Rückstand – „am Wochenende hatte ein Freund Geburtstag“, sagt er, macht sich aber keine Sorgen. Er wird es schaffen.
Mehr Studenten schneller und effektiver durchs Studium zu schicken, das war die Hoffnung, die sich mit dem Bologna-Prozess verband. Dass sie sich nicht bestätigt, haben erste Studien schon erwiesen: Bachelor-Studenten vor allem der Ingenieur- und Naturwissenschaften stoßen vermehrt an ihre Leistungsgrenzen, scheitern öfter in Prüfungen und brechen früher ab als zu Zeiten des Diploms und Magisters.
„Die Leichtigkeitslüge“ heißt ein viel diskutiertes Buch von Holger Noltze, Professor für Musikjournalismus an der TU Dortmund. Darin vertritt er die These, dass Anstrengung und der Umgang mit Komplexität unpopulär geworden sind, dass Beliebtheit und Marktgängigkeit zum Maß aller Dinge werden. Mehr und mehr Energie werde darauf verwendet, die Zielgruppe zu umwerben und ihr eine Sache möglichst leicht zu machen, die in Wahrheit große, ernsthafte Anstrengung bedeutet.
Wüsste man nicht, dass Holger Noltze damit den Musikbetrieb und die Branche der Musikvermittler gemeint hat – man könnte dabei an den akademischen Betrieb denken.
(Der Artikel erschien in der November-Ausgabe des Magazins K.WEST)