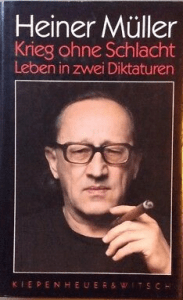Gags direkt aus der Tüte – Comödie Bochum mit dem Lustspiel „Endlich allein“
Von Bernd Berke
Bochum. Furchtbar, diese Nesthocker! Da wähnen die Eltern, sie hätten ihre Sprößlinge zu selbständigen Menschen erzogen und atmen bei deren Auszug schon dankbar auf: „Endlich allein!“ Doch kaum hat der mittlerweile 20- bis 30jährige Nachwuchs die ersten Problemchen mit Ehe oder Job, da kehrt er mit allen Ansprüchen ins traute Heim zurück. „Sie sind wie die Yo-Yos“, stöhnt die Mutter.
Kleine, im Grunde schrecklich harmlose Sticheleien zwischen den Generationen ergeben ein rechtes Familienprogramm fürs Boulevardtheater. Kein Wunder also, daß die erst seit ein paar Wochen auf dem Theatermarkt agierende „Comödie Bochum“ nun Lawrence Romans Lustspiel „Endlich allein“ (Regie: Gerhard Mohr) als bereits dritte Premiere auf den Plan setzt.
Sieben Türen sieht man auf der Bühne. In einer Komödie, in der es alsbald zünden und womöglich krachen soll, sind das schon die Hauptrequisiten auf der schlicht-realistischen Szene. Da erscheinen die Kontrahenten zum jeweils (un)passendsten Moment im Holzgeviert, und wenn sie sich erregen, werfen sie besagte Türen stets heftig zu. Manchmal geht es nur noch „klapp-klapp-klapp“ im kalifornischen Heim der Butlers. Denn die drei Söhne flattern samt weiblichem Logis-Gast nach Belieben ein und aus. Und immer schrillt ein Telefon.
Der Beginn wirkt trotzdem schleppend. Inge Marschall als Mutter Butler scheint für ihre Rolle nur eine einzige klagende Tonlage zu finden, sie spielt sich erst ganz langsam etwas wärmer. Hilfreich ist dabei sicherlich die (allerdings von Lauheit bedrohte) Routine eines Henning Gissel, der den Vater gibt. Zwischen unbeschwerter Munterkeit und trotteliger Frühvergreisung ziehen Stefan Hoßfeld, Rainer Kleinespel und Jörg Kernbach als Sohnes-Trio die Register, die nette junge Schauspieler halt so „drauf“ haben.
Zuweilen knackt es dabei leise im dramaturgischen Gebälk. Doch sie retten sich auch über kleine Sinnlücken hinweg, denn leicht ist der schnelle Instant-Gag zur Hand, gleichsam aus der Tüte gezaubert. Ist von einem Tölpel die Rede, läuft jener sogleich vor die Wand und schreit .„Aua!“ Doch wer eine schon nahezu unverschämt strahlende Schönheit wie Arzu Ermen (als Hausgast „Janie“) im Ensemble hat, braucht sich um optische Schwerpunkte kaum Sorgen zu machen.
Das Stück ist recht solide gebaut und daher zum Standardwerk der leichten Muse avanciert. Es enthält auch in Maßen nachdenkliche Passagen, die für eine Bühne des .„Comödien“-Zuschnitts fast schon zu lang dauern. Für (nicht subventionierte) Eintrittspreise um die 50 DM will die lachlustige Comödien-Kundschaft keine Weltverdüsterung sehen, wie sie Frank-Patrick Steckels Bochumer Schauspielhaus so nachdrücklich erzeugt.
Von wegen „Endlich allein“: Bühnenchef Jochen Schroeder muß sich nicht einsam fühlen, denn sein Haus verbucht derzeit eine regelmäßige Platzausnutzung von über 80 Prozent. Davon träumt Steckel. Wenn freilich demnächst der unbekümmerte Spaß-Regisseur Leander Haußmann das Schauspielhaus übernimmt, wird es – kein Paradox – ernste Frohsinns-Konkurrenz am Orte geben.
Comödie Bochum (Ostring 25, Nähe Hauptbahnhof). Weitere Vorstellungen von „Endlich allein“: Bis 8. Januar ’95, täglich außer montags, jeweils 20 Uhr.