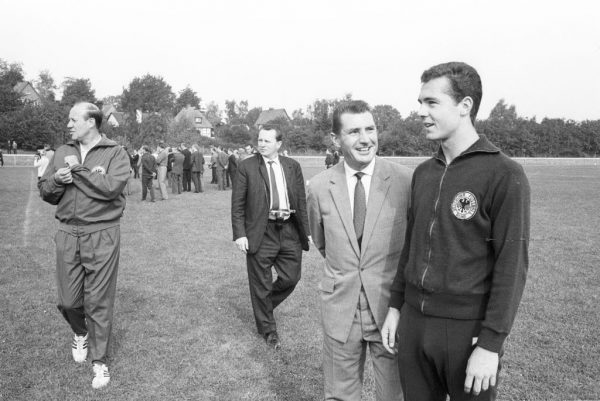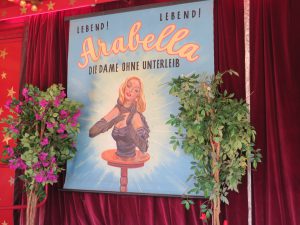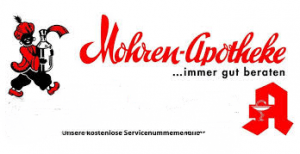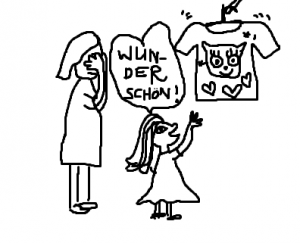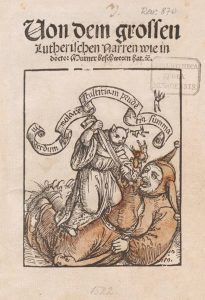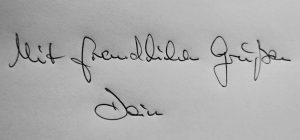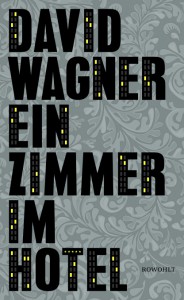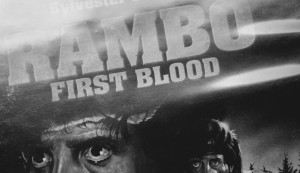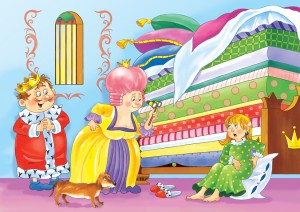Die Stadt, die auf ihre Autoren sch… – eine Polemik des Dortmunder Schriftstellers Jürgen Brôcan
Gastautor Jürgen Brôcan, u. a. Träger des Literaturpreises Ruhr, ist gar nicht gut auf die Stadt Dortmund zu sprechen. Eine Polemik des Autors:
Die Stadt Dortmund ist innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik leider nicht unbedingt für die gegenwärtig in ihr lebenden Schriftsteller bekannt. Ein wenig zu Unrecht, möchte man protestieren, denn es gibt hier durchaus eine Handvoll sehr wichtiger und sehr guter Autorinnen und Autoren, die Bedeutung über das Regionale hinaus haben. Doch das ist dem Oberbürgermeister und anderen Institutionen völlig gleichgültig, das kulturelle Renommee dieser Stadt wird sich also auch weiterhin im eher Unbedeutenden verlieren müssen. Wieder einmal hat sich die viel beklagte Provinzialität selbst geschaffen. Aber eines nach dem anderen…
Ich schreibe seit einigen Wochen in winzigsten Intervallen. Nicht weil mein Gedankenfluß immer wieder stocken würde, sondern weil ich auf die Augenblicke warten muß, in denen die Lärmmaschinen schweigen. Für das Warten auf diese Augenblicke braucht man Nerven, die dicker und haltbarer sind als Stahlseile. Noch ist man geschädigt von einer monatelangen Renovierung im Nachbarhaus, da lauten die Schreckensworte nun: „Abwasserkanalsanierung“, „Verdichter“, „Bagger“.
Baulärm ermordet Texte
Die Baustelle schleicht die Straße hinauf, hat jetzt fast mein Haus erreicht, doch schon zittern Fußböden und Wände, der Monitor auf meinem Schreibtisch wackelt gut sichtbar, die Bücherregale stöhnen, Gläser klirren, die Fensterrahmen knacksen, heute morgen gab sogar die Uhr an der Wand ungewohnte Geräusche von sich. Und einzelne, unrhythmische Stöße haben die Wirkung eines Tritts gegen das Schienbein; geschähe etwas Ähnliches auf der Straße, würde man vielleicht von Körperverletzung sprechen. Aber als Anwohner ist man jeglicher Rechtsmittel beraubt.
Und wessen man auch beraubt ist, neben dem Nervenkostüm, das ist die Kreativität. Unmöglich, unter solchen Umständen halbwegs konzentriert zu arbeiten. Für den freiberuflichen Schriftsteller stellt eine solche Situation eine Existenzbedrohung dar – monatelang nicht schreiben zu können bedeutet, monatelang kein Einkommen zu haben. Für solche Fälle müsse man vorsorgen, empfiehlt die Rechtssprechung vollmundig z.B. den von Straßenbaumaßnahmen betroffenen Unternehmen. Dem Schriftsteller, der sich von einem Monat zum anderen müht am unteren Ende der Fahnenstange, klingt das wie bitterster Hohn. Ich spreche erst gar nicht von den vielen Texten, die wie ungeborene Säuglinge abgetrieben oder gar nicht erst gezeugt werden –: Textmorde, Textdürre.
Wäre die Stadt Dortmund stolz auf ihre Schriftsteller, würde sie in solchen Fällen eine irgendwie geartete unbürokratische Hilfe anbieten. Aber sie ist nicht stolz. Sie haßt die Schriftsteller andererseits auch nicht, jedenfalls nicht erkennbar. Sie sind ihr einfach nur schnurzpiepegal.
Ein Brief an den Oberbürgermeister
Am 1.7.2019 habe ich dem Oberbürgermeister der Stadt Dortmund einen Brief geschrieben, in dem ich meine Situation erläutere, mit Verweis auf meine verschiedenen Auszeichnungen; unter anderem heißt es dort:
„Sehr geehrter Herr Sierau, ich möchte Sie bitten, im Rahmen Ihres Amtes als Oberbürgermeister, dem auch der Tiefbau untersteht, einmal darüber nachzudenken, in welche mißliche Lage solche Baumaßnahmen den auf eine gewisse Ruhe angewiesenen Kulturschaffenden bringen. Mir ist die Notwendigkeit dieser Maßnahmen natürlich – leider – durchaus bewußt, ich finde aber, sie dürfen nicht allein zu meinen Lasten und damit zu Lasten der Kultur stattfinden. ,Stadt Dortmund saniert Abwasserkanal – Schriftsteller kann sein Haus nicht mehr bezahlen und muß ausziehen‘: soll am Ende der Maßnahmen eine solche Schlagzeile stehen?
Würden Sie und die Stadt Dortmund ein irgendwie geartetes Entgegenkommen finden, um mir die gegenwärtige, ganz textarme Situation zu erleichtern, können Sie sich meines Dankes sicher sein. Wäre es nicht schön, ich könnte einmal z.B. in einer international gelesenen Zeitung darüber berichten, daß sich die für Kultur nicht sonderlich bekannte Stadt Dortmund der Probleme eines Schriftstellers annähme?“
Notwendigkeit der Instandhaltung
Bereits am 4.7. erreicht mich ein Brief von einer leitenden Stelle der Stadtentwässerung Dortmund, an die meine „Zuschrift“ zuständigkeitshalber zur Beantwortung weitergeleitet worden sei. Der Unterzeichner betont die Notwendigkeit der Instandhaltung von Abwasseranlagen (die von mir nie bezweifelt wurde) – in einer recht phrasenhaften Sprache. Er geht nicht im geringsten auf mein Anliegen ein und bittet mich zum Schluß pauschal um „Verständnis“. Ist es echter Hohn, ist es nur Desinteresse, die da sprechen? Wer kann das entscheiden?
Immerhin freundlich und mitfühlend hat mir das Kulturbüro geantwortet. Doch auch ihm sind die Hände, sprich: die Mittel gebunden. Man verweist mich auf soziale Hilfeträger oder auf die verschiedenen Lesesäle. Also: einen Laptop kaufen und jeden Tag mit mehreren schweren Taschen voller Bücher – denn ich arbeite stets an einigen Projekten gleichzeitig – in die Busse und Straßenbahnen steigen. Unkosten und Aufwand, zu denen mich eine von mir nicht erwünschte Kanalsanierung nötigt. Außerdem: selbst schuld, wer so sensibel ist, daß er sich erst mühsam an eine neue Schreibumgebung gewöhnen müßte.
Also doch lieber zu Hause bleiben, mir den Verstand durchrütteln lassen und aufpassen, daß nicht ein Regal beim Gesang der Verdichter aus den Fugen gerät? Natürlich, täglich gehen Tausende Menschen zu ihrem Arbeitsplatz – aber der ist wahrscheinlich kein Exil, in das sie geschickt werden, ohne Entschuldigung, eiskalt, gleichgültig.
„Am Ende muß ich Mundraub begehen…“
Am Ende werde ich vielleicht mein Haus verlieren, weil ich die monatlichen Raten an die Bank nicht mehr aufbringen kann. Am Ende wird mich vielleicht das Finanzamt der Steuerhinterziehung beschuldigen, weil es nicht glauben kann, wie wenig ich in diesem Jahr verdient habe. Am Ende muß ich Mundraub begehen, weil ich mir nicht mehr leisten kann, etwas zu essen zu kaufen. Vielleicht sollte ich mir überlegen, ein paar Arbeiter schwer zu verletzen, denn im Knast wäre ich zumindest versorgt – am Ende allemal besser, als hier zu sitzen und nichts tun zu können.
Eins weiß ich aber sicher: Ich werde in Dortmund keine Lesung aus meinen Büchern mehr veranstalten – außer der einen, bereits vertraglich vereinbarten – und ich werde keine weiteren Texte mehr über diese Stadt schreiben, die ich mehr als einmal zu einer der interessantesten der Welt erklärt habe; denn ein solches Prädikat verdient sie nicht länger.