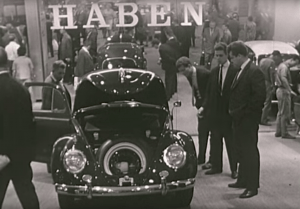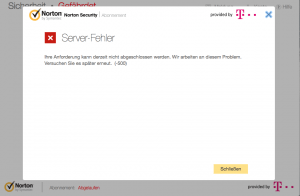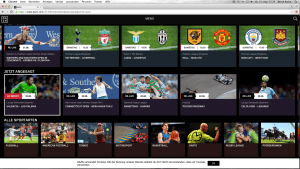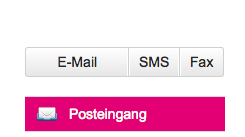„Stop and Go“: Dortmunder DASA zeigt Ausstellung über Mobilität, Entschleunigung und Stillstand
…und schon wieder lockt die Dortmunder Arbeitswelt-Ausstellung DASA mit einer neuen Schau. Seit September widmet man sich mit „Tüftelgenies“ den Erfindungen der Menschheit (vom Faustkeil bis zum Computer), jetzt geht es auf einem anderen Areal im zweiten Stock des weitläufigen Hauses um Mobilität im vielerlei Hinsicht.
„Stop and Go“ lautet der Obertitel der insgesamt zehn Themeninseln, die vor allem mit etlichen Audio- und Videostationen animieren sollen. Gleich eingangs kann man sich entscheiden, durch welche Tür man die Ausstellung betreten möchte – je nachdem, ob man mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zur DASA gekommen ist; wie denn überhaupt regelmäßig beim individuellen Verhalten angeknüpft wird. Es ist ja ohnehin ein DASA-Bekenntnis: die Leute da abholen, wo sie sind. Projektleiter Philipp Horst und sein Team (Ria Glaue, Luisa Kern, Magdalena Roß) haben das Motto recht konsequent umgesetzt.
Die Lust an der Raserei und der Stau
Die vielfältigen Verkehrsthemen werden nicht nur mit Infos und Statistiken, sondern auch assoziativ umkreist. So reicht das Spektrum beim Kfz von der überwiegend arbeitsbedingten Mobilität (Pendler und Berufe wie S-Bahn-Fahrer) über die Lust an der Raserei, die man im Fahrsimulator oder mit einer Carrera-Bahn gefahrlos erproben kann, bis hin zu allfälligen Staus, deren Entstehung sich hier per Touchscreen virtuell beeinflussen lässt. Ach, könnte man den zähfließenden Verkehr in der Wirklichkeit doch auch so willentlich steuern! Wissenschaftlich belegt ist jedenfalls, dass täglich absehbare Staus längst nicht so stressig sind wie unvorhergesehene.
Dann also lieber öffentliche Verkehrsmitteln nutzen? Wer sich in diesen Teil der Ausstellung begibt, vernimmt über Kopfhörer einige kleine Erzählungen über Bequemlichkeits-Vorteile und (anregende, peinliche oder gar bedrohliche) menschliche Begegnungen, über Unzulänglichkeiten und Verspätungen. Ja, man bekommt sogar ein paar dosierte Geruchsproben verabreicht – abgestandene Pizza, lästiges Parfüm. Bäh! Nun ja, wenn die Fahrt ansonsten dem Umweltschutz dient… Nachhaltiger als jedes Auto ist natürlich auch das Fahrrad. Freilich veranschaulichen Karten (Rätselspiel: Welche Stadt hat welches Radwegenetz?), dass es meistenteils noch sehr an der Infrastruktur hapert und dass Radfahren im urbanen Raum deshalb ziemlich gefährlich sein kann.
Auch freiwillige und erholsame Entschleunigung wird ins Visier genommen. Kinder haben ihre Wege zur Grundschule nachgezeichnet. Kein Wunder: Wer mit dem Auto gebracht wird, nimmt viel weniger Details aus der Umgebung wahr als die Fußgänger. Derlei Erkenntnisse bekräftigt auch die Promenadologie, jene noch recht junge Wissenschaft vom Gehen. Übrigens: Im 19. Jahrhundert führte manch ein flanierender Dandy wahrhaftig eine Schildkröte spazieren, um zu demonstrieren, wie viel Zeit er zur Verfügung hatte. Schon damals war’s ein Statuszeichnen.
Parkflächen-Wahnsinn
Vorhin war von Staus die Rede. Der zwangsläufig häufig ruhende Verkehr kommt mehrmals vor, beispielsweise auch, wenn es um den Wahnsinn des Parkflächenverbrauchs geht. Alle Besucher können Ideen beisteuern, wie man sonst noch mit all dem Grund und Boden von Straßen und Parkplätzen umgehen könnte: als Bühne für Kreativität nutzen, offen oder heimlich Anpflanzungen vornehmen, bis zum nächsten Regen den Asphalt bunt besprühen… Und was fällt Ihnen ein?
Sinnfällig zudem eine transparente Box mit Hunderten von „Knöllchen“ aus Dortmunder Herstellung. Wer argwöhnt, die Stadt wolle immerzu nur in Bürgers Geldbeutel greifen, wird staunen, wenn er hört, dass jede(r) Kontrolleur(in) pro Tag im Schnitt nur 12 Zettel verteilt. Für die Kommune ist es also ein herbes Minusgeschäft. Es geht eben vorwiegend um „Erziehung“.
Apropos Pädagogik: Die Grundlinien der Ausstellung laufen auf Abschaffung des herkömmlichen Automobils hinaus, man spürt immer mal wieder mehr oder weniger sanfte Anstöße zur Verhaltensänderung im Sinne der PS-Abstinenz. Umweltverbände dürften sicherlich weitgehend einverstanden sein, die Autolobby wohl weniger. Dabei spielen die übelsten Verpester im Weltverkehr hier noch gar keine Rolle, nämlich Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge.
Viel Stoff auf begrenzter Fläche
Die Auto-Vergötterung wird längst nur noch (allenfalls) mit nachsichtigem Lächeln zur Kenntnis genommen, sie materialisiert sich hier in einem vergoldeten und aufgemotzten Opel Corsa. Ein „Hingucker“, von dem man sich allerdings gern schnell wieder abwendet. Es muss doch wohl schon elend lange her sein, dass so etwas als „cool“ gegolten hat.
Kaum minder auffällige Gegenstücke zum Corsa sind ein nostalgischer VW-Bus von 1972 mit Camper-Zubehör, der für Freiheitsträume nicht nur der Hippie-Generation steht, und ein vielleicht zukunftsträchtiges Solarmobil der Bochumer Uni, immerhin rund 120 km/h schnell und mit erstaunlichen 700 Kilometern Reichweite pro Aufladung. Und da man schon einmal dabei ist, geht’s u. a. noch um Carsharing und autonomes Fahren. Sehr viel Stoff auf relativ kleiner Fläche.
Kultverdächtig ist derweil noch ein ganz anderes Automodell: Am Eingang stehen einige Bobby Cars, mit denen höchstens Sechsjährige (die ansonsten thematisch deutlich überfordert sind) durch die Schau sausen und Wimmelbilder auf Kinderaugenhöhe ansteuern dürfen. Ich wage mal die Prognose, dass das Treiben rasch chaotische Formen annehmen kann und gelegentlich reglementiert, wenn nicht gar unterbunden werden muss.
„Stop an Go“. Eine Ausstellung zur Mobilität. DASA (Arbeitswelt Ausstellung), Dortmund, Friedrich-Henkel-Weg 1-25 (Nähe TU / Universität). Vom 26. Oktober 2018 bis zum 14. Juli 2019. Mo-Fr 9-17 Uhr, Sa/So/Feiertage 10-18 Uhr. Eintritt (inklusive Begleitheft): Erwachsene 8 €, ermäßigt 5 €, Schulklassen pro Kopf 2 €. — Tel.: 0231 / 90 71 26 45.
Weitere Infos: www.dasa-dortmund.de
____________________________________________________________
P.S.: Tags zuvor rein privat mit mehreren Kindern die anfangs erwähnte Ausstellung „Tüftelgenies“ (noch bis zum 31. März 2019) zu wichtigen Erfindungen der Menschheit besucht. Die teilweise pfiffig gemachte Schau bietet einige interessante Einblicke, die vermutlich haften bleiben, sie ist tatsächlich auch schon für Sieben- oder Achtjährige geeignet, allerdings sehr schnell überfüllt.
Gewiss, es war ein museumsträchtiger, weil regnerischer Ferientag, aber nächste Woche kommen dann auch wieder Schulklassen. Es bleibt sich vom Andrang her ungefähr gleich. Eng wird’s vor allem dann, wenn mal wieder mehrere Stationen nicht funktionieren und erst einmal repariert werden müssen. Darf man auf Besserung hoffen?