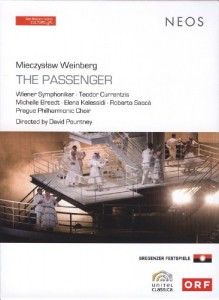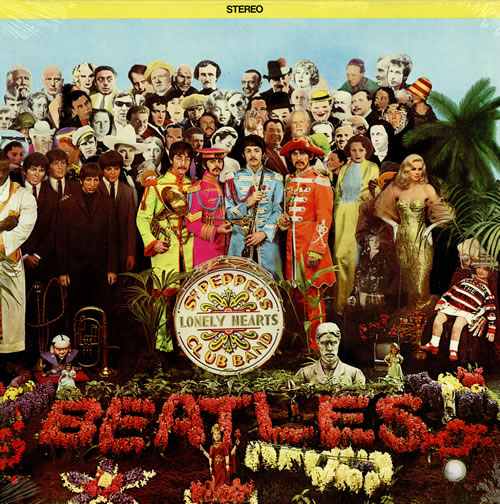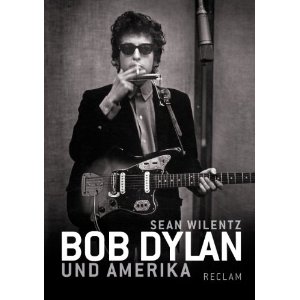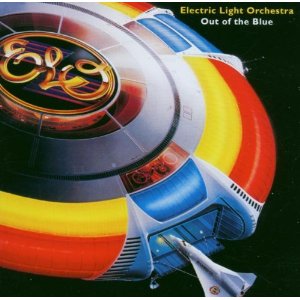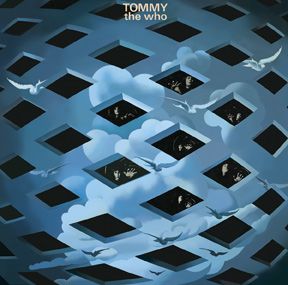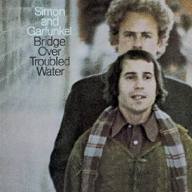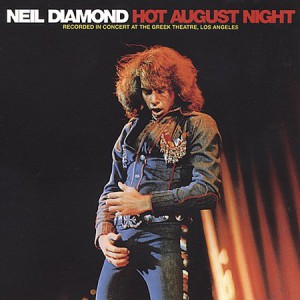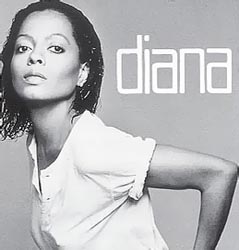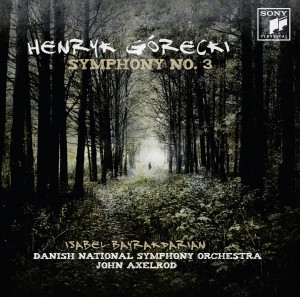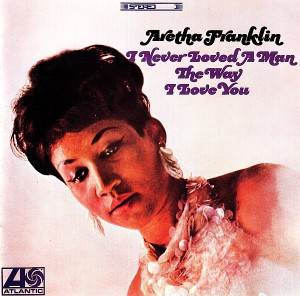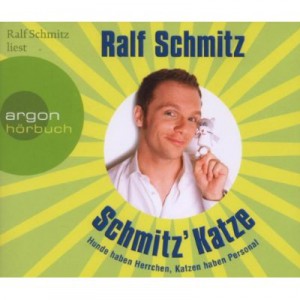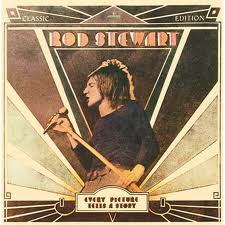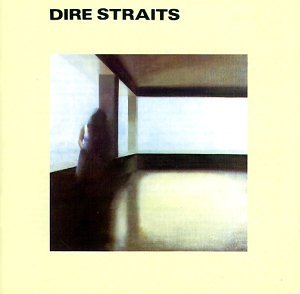Auschwitz auf der Opernbühne: „Die Passagierin“ als DVD-Edition
Dies ist eine nachdrückliche Empfehlung: Die DVD der Bregenzer Aufführung von Mieczysław Weinbergs Oper „Die Passagierin“ überzeugt durch präzise Inszenierung, durchdachtes Bühnenbild, spannungsvollen Handlungsablauf, die Figurenzeichnung und -verkörperung, die Rezitative sowie den Einzel- und Chorgesang und durch die orchestrale Musik.
Nie hätte ich vorher gedacht, dass es möglich wäre, noch dazu überzeugend möglich wäre, ein derartiges Thema ins Zentrum einer Oper zu stellen. Zwar, dass man sich auch an diesem Thema mal vergreifen können würde, habe ich schon vor 30 Jahren geargwöhnt, als ich mal gesprächsweise prognostizierte, dass der Tag nicht fern sei, dass man auch aus Auschwitz noch ein Musical machen werde.
Was ich damals noch nicht wusste, was fast jeder nicht wissen konnte, war dies, dass eine Oper zu diesem Thema schon seit dem Jahre 1968 existierte. Eine Oper übrigens, die auch ihr Komponist, ein russischer Komponist mit polnisch-jüdischen Wurzeln, den ich vor drei Jahren noch nicht einmal namentlich kannte, zeitlebens nie in einer Aufführung hören konnte, nämlich weil sie nie aufgeführt wurde, in der UdSSR nicht aufgeführt werden durfte.
„Als er in den letzten Jahren seines Lebens gefragt wurde, welches Werk er für sein wichtigstes halte, antwortete Weinberg ohne Zögern: D i e P a s s a g i e r i n. Noch zwei Tage vor seinem Tod 1996 klagte er gegenüber Alexander Medwedjew, dem Librettisten des Werkes und bedeutenden Musikwissenschaftler, dass er das Werk nie gehört habe. Um ihn zu trösten, versprach Medwedjew, ,doppelt‘ genau zu hören, falls die Uraufführung jemals stattfinden würde: einmal für den Komponisten und einmal für sich selbst. Medwedjew konnte sein Versprechen am 25. Dezember 2006 bei der konzertanten Aufführung des Werkes im Swetlanow-Saal des Moskauer Hauses der Komponisten einlösen.“ (Zitat aus David Fanning: Mieczysław Weinberg / Auf der Suche nach Freiheit“ / aus dem Englischen von Jens Hagestedt, Wolke Verlag, Hofheim 2010, S. 131)
Im Sommer 2010 hatte ich zwar in einem sehr positiven Bericht der Sendung „Kulturzeit“ in 3sat mitbekommen, dass Weinbergs Oper im Rahmen der Bregenzer Festspiele aufgeführt worden sei, ohne dass ich diesen Hinweis damals mehr als zur Kenntnis nahm. Erst in diesem Jahr wurde ich wieder auf Weinberg aufmerksam, zunächst durch die ganz hervorragenden, brandaktuellen Aufnahmen seiner sämtlichen Violinwerke auf 3 CDs mit Linus Roth, Violine, und José Gallardo, Klavier, dann durch 4 (inzwischen 6) CDs mit den von dem Quatuor Danel dargebotenen Streichquartetten Weinbergs, und schließlich, nachdem ich endlich gemerkt hatte, welch großartigen Komponisten ich bislang noch nicht gekannt hatte, die Opern-DVD „The Passenger“ (op. 97), von der hier vor allem die Rede ist.
Fürs Fach Deutsch war in der gymnasialen Oberstufe in NRW vor nicht allzulanger Zeit noch Bernhard Schlinks Roman „Der Vorleser“ als Kurs-Lektüre verbindlich vorgeschrieben. Dieser Roman kam (trotz aller kritischen Vorbehalte, die man haben könnte; vgl. etwa die Rezension von Jeremy Adler) bei den Schülern in der Regel gut bis sehr gut an. Dies habe ich in meiner allerletzten aktiven Zeit als Lehrer noch mitbekommen. Heute würde ich ganz entschieden diesen Roman mit der zunächst ganz ähnlich in deutscher Nach-Auschwitz-Zeit ansetzenden Oper konfrontieren: als Ergänzung und Kontrast für eine mit ziemlicher Sicherheit noch ergiebigere Besprechung.
Wer Opern immer noch vorurteilsvoll grundsätzlich meidet, könnte sich zumindest die der Oper zugrundeliegende Romanvorlage der polnischen Auschwitz-Überlebenden Zofia Posmysz aus dem Jahre 1962 etwas genauer ansehen. Dieser Roman mit dem gleichen Titel „Die Passagierin“ erschien auf deutsch erstmals 1969 in der Übersetzung von Peter Ball und ist inzwischen wieder neu aufgelegt worden.
Die Opern-DVD überrascht übrigens auch durch eine außergewöhnlich gute Kameraführung und durch exzellente, sehr aufschlussreiche Extras, so mit einem Documentary unter dem Titel „In der Fremde“. (Je nach dem, wo man diese DVD der Firma NEOS erwirbt, kostet sie zwischen 30 und 40 Euro.)