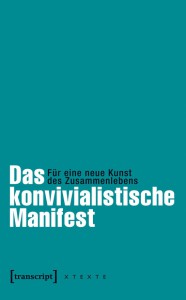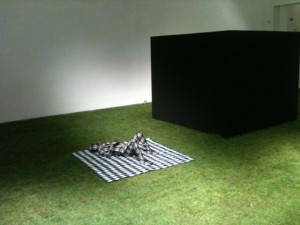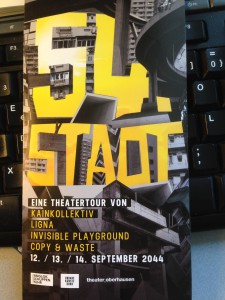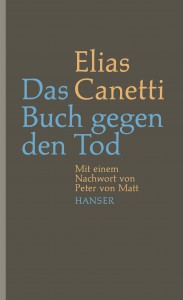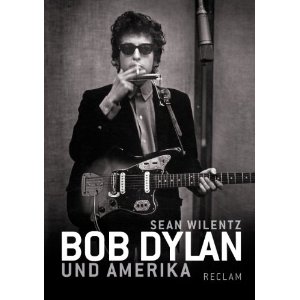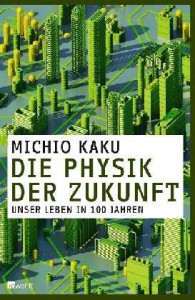Literaturhaus-Fata Morgana oder doch nur Kurpark in Bad Oeynhausen?
„Vielleicht ist es das, was mich an Oberhausen herausfordert: Daß man die Stellen kennen muß. Die Plätze, an denen aus nichts ‚etwas‘ wird. Daß es Orte gibt, direkt in Oberhausen, die sind genau wie Frankreich, Berlin oder Neapel, ich schaue mich nur um und kann atmen, es gibt Stellen in Oberhausen, an denen kann man tatsächlich atmen.“
Martin Skoda in seiner Erzählung „Oberhausen“ (in: Dokumentation zum Oberhausener Literaturpreis 1999, Verlag Karl Maria Laufen, Oberhausen 1999)
Abseits aller „Masterpläne“:
Das Europäische Literaturhaus/Literaturnetz Ruhr (ELR)
Neben Verlagsförderung, Reisestipendien und Schreibaufträgen für Schriftstellerinnen und Schriftsteller werbe ich vom Literaturbüro Ruhr e.V. aus (seit fast zwei Jahrzehnten!) beharrlich für die Gründung eines regional verankerten Europäischen Literaturhauses Ruhr (ELR) mit offenem Konzept. Dieses ELR könnte auch der Mittelpunkt eines möglichen Europäischen Literaturnetzes Ruhr sein, das literarische Initiativen aus der Region aufnähme und in sie hineinwirkte, sie förderte und weiterentwickelte.
Wäre eine solche Gründung kulturpolitisch gewollt, sie ließe sich zügig diskutieren und umsetzen. Ein EUROPÄISCHES LITERATURHAUS RUHR könnte bescheiden (aber bitte nicht zu bescheiden) starten, um dann nach und nach zu wachsen. Im Verhältnis etwa zu noch mehr Philharmonien und Kreativwirtschafts-Zentren benötigte ein ELR erheblich weniger Zuschüsse, wäre preiswerter und eine echte (überfällige) Bereicherung des kulturellen Lebens an der Ruhr.
Das Ruhrgebiet hat hier enormen Nachholbedarf, ist zurzeit schlicht abgekoppelt von vielen Strukturen literarischen Lebens im deutschsprachigen Raum. Literaturhäuser finden sich zwar nicht, wohin man schaut, aber wenn man erst einmal genauer schaut, dann sichtet man respektable Häuser z.B. in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart, Kiel, Köln, Leipzig, Dresden, Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg, Zürich und Basel. Insgesamt gibt es weit über 20 Einrichtungen, die Literaturhäuser sind – oder sich manchmal auch nur so nennen. Gemeinsam bilden elf von ihnen das ‚Netzwerk Literaturhäuser‘, www.literaturhaus.net/.
Daneben gedeihen zudem verwandte Einrichtungen: in Berlin etwa die LiteraturWERKstatt, das Literarische Colloquium (LCB) und das Literaturforum im Brecht-Haus, andernorts auch Künstlerhöfe wie in Schöppingen oder Edenkoben, dazu die Akademie Schloss Solitude …
Allein in Berlin also leistet man sich nicht nur mehrere Häuser für Literatur (mit unterschiedlichen Konzepten und Programmen), Berlin nutzt sie auch, um seine metropole Vorrangstellung im Literaturbetrieb auszubauen. Man sieht in prominenten Orten der Literatur die Facetten eines lebendigen ‚Kulturbetriebs‘, der auch vom Literaturmarkt lebt und ihn vice versa bereichert. Über 300 Verlage beherbergt Berlin und ist mit Milliarden-Umsatz die größte Stadt des Bucheinzelhandels. Anderswo weiß man also sehr gut um die Verbindung von geistigem Leben, lebendigen Orten und Geschäft.
Schaut man dagegen auf der Suche nach einem Literaturhaus im deutschsprachigen Raum ins fünf Millionen Einwohner starke Ruhrgebiet, dann heißt es: Fehlanzeige, kein solch ausstrahlender singulärer Ort, nirgends.
Ein Ort für die Lust am Text
Dabei könnte ein Europäisches Literaturhaus Ruhr als Knoten- und Kristallisationspunkt fürs literarisch-künstlerische Leben im Revier viel bewegen, sogar – aber eben nicht zuallererst – unter kulturwirtschaftlichen Aspekten. Es böte endlich einen sichtbaren und begehbaren Ort für Literatur. Es könnte das Forum sein für die Begegnung mit Literatur in all ihren Schattierungen, ein Ort „für die Lust am Text“ (Roland Barthes), ein Ort der Literaturvermittlung, der Konzentration, des spielerischen Umgangs wie des Widerspruchs, ein Ort für Leser, Schriftsteller, Verleger und Kritiker im Gespräch und Ideenaustausch, ein Ort der Vorstellung vergessener und zu entdeckender Schriftsteller, ein Haus der Zusammenarbeit von Literaten mit anderen Künsten und Medien. Regional verwurzelt und weltoffen, wäre ein Europäisches Literaturhaus Ruhr (auch als Mittelpunkt eines Literaturnetzes Ruhr) ein Tor zur Welt der Sprache und Dichtung.
Tagtraum
Man stelle sich vor: In einem Europäischen Literaturhaus Ruhr träfen sich gute Autorinnen und Autoren aus aller Welt, also auch aus NRW und der Region. Gespräche über alles, was mit Literatur zu tun hätte, würden dort geführt, man stritte, äße und tränke, kaufte sich Bücher, läse, sähe Literatur-Ausstellungen, Literaturverfilmungen, hörte mit Freunden Lyrik & Jazz, mit den Kleinen die besten Kinderbuchautoren, wärmte sich gelegentlich Herz und Verstand an literarisch-politischer Kleinkunst, hörte eine Nacht lang Mülheimer oder Bochumer Schauspielern zu, die aus dem „Ulysses“ läsen, besuchte zum ersten Mal ein „poetry café“, griffe gelegentlich sogar in literarische, politische und philosophische Debatten ein, um nicht als Konsumenten-Narziss das Leben nur blöde zu vertrödeln.
Junge und ältere Autoren träfen sich zu Textdiskussionen und Werkstattgesprächen, lernten von versierten Kollegen in Meisterklassen auf Zeit etwas über das Handwerk des Schreibens. Schriftsteller lüden Musiker, Maler … ein, um an Libretti zu arbeiten, Texte und Grafik zu einem Buch zusammenzustellen oder gleich gemeinsam eine Graphic Novel zu gestalten, während nebenan Videokünstler ihren Clip zu einem Gedicht Barbara Köhlers aus Duisburg schnitten. Was für ein lebendiges Haus! Und die Wahrnehmung durch die Literatur-Community des deutschsprachigen Raumes ergäbe sich durch die Qualität der Projekte und teilnehmenden Autoren ganz nebenbei.
„Wo kämen wir denn da hin“, dichtete der Schweizer Kurt Marti, „wenn alle sagten, wo kämen wir denn da hin, und niemand ginge, um zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.“
Nüchternheit und Mut zur Größe
Argumente gegen ein Literaturhaus gibt es natürlich genug. So einst auch rund um die Gründung der Literaturhäuser in Frankfurt, München und anderswo. In den Diskussionen um die Literaturhäuser in Berlin oder Hamburg hörte man einst vor deren Gründung ziemlich düstere Horrorvisionen eitler Vereitler. Zum Beispiel die von den Villen, in denen die Avantgarde ganz nebenbei zwischen Plüsch und Pomp erstickt würde. Oder die Vision vom Clubhaus für den Klüngel, von der Schwätzerbude für Hobby-Literaten, oder die von der subventionierten Sozialstation für alle, die ihre Tinte nicht halten könnten, von der Wärmestube für lokale Heimatdichter.
Ähnlich Überzogenes raunten aber auch die Befürworter von Literaturhäusern. In ihren Konzepten überfrachteten sie die Literaturhäuser so mit Hoffnung, dass die unter solcher Last als virtuelle Luft- und Lustschlösser schon einstürzten, bevor sie als Bau dastanden.
Ein Literaturhaus auf dem Papier bot und bietet tausendfach alles unter einem Dach: „die zeitgemäße Form des Salons der Rahel Varnhagen“ (Diepgen in Berlin), Caféhaus für Autoren und die demokratisch-literarische Öffentlichkeit, Schreibschule, Haus der Autorinnenförderung und Multi-Kulti-Austausch, Dokumentationszentrum, Medienwerkstatt, Autorenwohnung, Buchladen, Experimentierbühne und so weiter…
Auch dieses Statement hier steht in der Gefahr, einem Europäischen Literaturhaus Ruhr und seinen möglichen Befürwortern zu viel zuzumuten, doch andererseits: Das Literaturhaus wird hier präsentiert als ein Ort, an dem nichts weniger geschähe, als dass mit Hilfe der Literatur über Kunst, uns und unsere Gesellschaft nachgedacht würde.
Lernen am Modell: Hamburg und Berlin
Wer wirklich ein Europäisches Literaturhaus Ruhr will, sollte genauer z.B. nach Hamburg und Berlin schauen und von den dortigen Muster-Häusern gründlich lernen.
In Berlin erklärte einst Herbert Wiesner: „Wir verstehen uns als ein Haus der Literatur für Berlin, aber nicht als ein Haus der Berliner Literatur, nicht nur jedenfalls. Obwohl Berliner Autoren bei uns auftreten, sind wir sind kein Clubhaus für Berliner Schriftsteller. Wir arbeiten, um eine im Grunde zwar anerkannte, aber schwierigere, sich nicht von selbst schon vermittelnde Literatur vorzustellen. Ein Literaturhaus, das nur eine Aneinanderreihung von Lesungen böte, hätte keine Berechtigung“.
Ähnlich sah es auch Uwe Lucks, einer der ersten Geschäftsführer in Hamburg: „Also populistisch gehen wir nicht vor. Uns interessiert Qualität. Wir konzentrieren uns auf das, was uns wichtig erscheint. Das ist die Präsentation der aktuellen internationalen literarischen Szene.“
Im Hamburger Haus an der Innenalster präsentiert man noch heute ein anspruchsvolles, manchmal sperriges Programm, das Flagge zeigt, ohne zu vergessen, dass es viele verschiedene Leser gibt, mit vielen verschiedenen Lesebedürfnissen.
Ansteckend lebhaft
Beide Häuser öffnen anderen literarischen Vereinigungen ihr Haus als Forum und geben ihnen die Möglichkeit, kostenlos Veranstaltungen durchzuführen. So reicht man etwas von den eigenen Subventionen weiter. Unkenrufe von Kritikern, die glaubten, ein zentrales Literaturhaus veröde die literarische Szene einer Großstadtregion und nähme den anderen Initiativen Geld oder Publikum weg, haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil. „Es hat ja nur einen sehr kleinen Literaturetat gegeben, bevor wir überhaupt antraten. Wir haben die Kulturbehörde über unsere Existenz eher motiviert, viel mehr für Literatur in Hamburg insgesamt zu tun“, sagte Uwe Lucks in Hamburg, und Herbert Wiesner bilanzierte in Berlin: „Was kleinere Literaturinitiativen angeht, da gab´s sogar einen Schub von Neugründungen, seitdem unser Literaturhaus die Arbeit aufgenommen hat.“
Die Trägervereine beider Literaturhäuser bekamen ihre denkmalgeschützten Gebäude kostenlos renoviert und residier(t)en dort mietfrei. Beim Berliner Literaturhaus jedoch wurden (anders als in Hamburg) Programm und Haus noch stärker von der öffentlichen Hand gefördert. Aber auch die Berliner müssen dazuverdienen. Über Mitgliederbeiträge, Spenden, Eintrittspreise bei Veranstaltungen, die Verpachtung des Erdgeschosses ans Café „Wintergarten“ und des Souterrains an den Buchladen, über Vermietungen und wechselnde Sponsoren.
Ankommen und stiften gehen
Ich fasse einmal das Rezept für ein Literaturhaus zusammen:
Man nehme eine Handvoll Enthusiasten, die hoffentlich wenig Image- oder Ego-Probleme haben. Die tatkräftig sind, die konzeptionell denken können. Die Fortune haben, Ausdauer bei der Suche nach einem geeigneten Haus (gefördert aus Mitteln des Denkmalschutzes oder der Städtebauförderung des Landes), bei der Einbindung gediegener Mäzene und Stiftungen, souveräner Sponsoren, bei der Ansprache von Politikern und den Kulturbehörden.
Sicher jedenfalls ist: Ohne eine Stiftung geht wahrscheinlich gar nichts.
Vom Duisburger Lehmbruck Museum zum Beispiel und seinem engagierten Ex-Leiter, Dr. Christoph Brockhaus, wäre zu lernen, wie man sich über eine Stiftung finanziell unabhängiger macht und auf Teile von Dauer-Subventionen verzichten kann.
Warum überhaupt ein Literaturhaus?
Weil der Geist weht, wo er will, aber am liebsten dort, wo Intelligentes schon in der Luft liegt. Weil alle Künste im Ruhrgebiet feste Häuser haben, in denen Kunst gemacht und/oder dem Publikum präsentiert wird, die Literatur aber nicht.
Buchhandlungen und selbst (Stadt-)Bibliotheken bieten hier keine Alternative, auch weil es ihnen zurzeit in den Städten finanziell und auf dem Markt an den Kragen geht. Stadtbibliotheken bleiben vor allem Orte der Ausleihe, des Lesens, die daneben vielen anderen Zwecken dienen. Mit großer Anstrengung leisten es die besten unter ihnen, temporäre, flüchtige Veranstaltungsorte für zwei, drei Stunden zu sein, Mittelpunkte aber des literarischen Lebens in all seinen Facetten, Impulsgeber des literarischen Diskurses, der literarischen Produktion sind sie so nicht.
Insel der Phantasie
In einem Literaturhaus bestünde die Chance, die Begegnung mit Literatur und Schriftstellern tatsächlich zu kultivieren, abseits von bloßem Bestseller-Marketing oder Lesung-als-Gottesdienst-Kulisse. Literatur, Schreiben und Lesen, öffentliche Lektüre und Diskussion haben das Zeug dazu, „Kult“ zu werden. Literarische Geselligkeit erlebt seit längerer Zeit eine Renaissance, bietet genau den geistigen Luxus, den sich in einer offenen Gesellschaft alle die leisten, die kritisches Denken nicht nur simulieren, sondern auch stimulieren wollen.
Ein Literaturhaus wäre die Insel der hintergründigen Phantasie im Meer der vordergründigen Fun-Kultur. Der Literatur, den Gesprächen über Literatur täte es gut, etwas mehr als bisher um ihrer Inhalte willen ‚inszeniert‘ zu werden. Dazu bedarf es einer kultivierten Umgebung. Es wird Zeit, dass der Stil, den man von Autoren und ihren Texten fordert, endlich auch im Umgang mit Schriftstellern und ihren Werken geboten würde.
Warum ein E-u-r-o-p-ä-i-s-c-h-e-s Literaturhaus?
Das wissen wir alle: Historisch ist das Ruhrgebiet geprägt von Zuwanderern, kulturellen Einflüssen aus ganz Europa und weltweitem Handel. In dieser Metropolregion, zentral gelegen in einem Europa der Regionen, lässt sich Literaturförderung gar nicht anders denken als im Spannungsfeld von lokaler Verwurzelung und internationalen Beziehungen, von Identitätssuche und Weltoffenheit. Ein Europäisches Literaturhaus Ruhr hätte die Vielfalt und Einzigartigkeit internationaler Literaturen und Sprachen zu präsentieren und zu vermitteln, das darin zu entdeckende Widerständige, Fremde und Neue. Das Literaturhaus hätte Leserinnen und Lesern Orientierungen in der Welt der Bücher zu ermöglichen und mit internationalen Projektpartnern Lesekultur zu gestalten.
Eine Adresse für die Präsentation von Weltliteratur
Die literarische Öffentlichkeit könnte vom regen „Import“ internationaler Literatur profitieren. Schon für das Literaturbüro Ruhr e.V., das ich leite, lasen und lesen von den frühen Nächten der Literatur bis zu den interkulturellen Literaturprojekten heute Österreicher, Schweizer, Spanier, Franzosen, Türken, Russen, US- und Süd-Amerikaner, Ungarn und Polen, Argentinier und Nicaraguaner, Marokkaner und Algerier. Endlich hätte die Vorstellung von Weltliteratur im Ruhrgebiet auch eine feste Adresse.
Daran wären nicht zuletzt die (großen) Verlage interessiert, für die erst in einem solchen Rahmen Kooperationen und Förderungen interessant werden. So unterstützte die Bertelsmann Buch AG im Literaturhaus Frankfurt z.B. das 1. Internationale Literaturgespräch; das Thema: die Rolle der deutschsprachigen Literatur im Ausland. Die Bertelsmann Stiftung veranstaltete im Literaturhaus München und im Europäischen Übersetzer Kollegium Straelen am linken Niederrhein Autorenweiterbildungen und internationale Übersetzer-Treffen.
Seit jeher beeinflussen sich Literaten und Literaturen über alle Grenzen und Zeiten hinweg in ihren Themen, Figuren, literarischen Mitteln. Jede Literaturvermittlung – auch in einem Literaturhaus – hat heute auf diese Intertextualität durch ein internationales Programm zu reagieren, das von der literaturwissenschaftlichen Komparatistik profitieren sollte, wo immer es ginge.
Dass ein Europäisches Literaturhaus Ruhr sich nicht als ein Haus versteht, das sich auf die Präsentation europäischer Literatur beschränkt, versteht sich so von selbst. Im Gegenteil: Im komparatistischen und intertextuellen Vergleich von Nationalliteraturen, europäischer Literatur und Literatur der Welt, im lebendigen Austausch mit Autorinnen und Autoren erst ergeben sich die neuen Perspektiven einer international-globalisierten Literatur, die ohne ihre jeweiligen Wurzeln nicht zu verstehen ist.
Warum ein Europäisches Literaturhaus R-u-h-r?
Das literarische Leben hat – wie beschrieben – kein wirklich adäquates Zuhause im Ruhrgebiet, kein Obdach, bestenfalls Unterstellplätze und Tagesherbergen. Ein Europäisches Literaturhaus Ruhr hätte auf die besonderen Gegebenheiten des Reviers zu reagieren (karge Verlagslandschaft, fehlende Feuilletonvielfalt, fehlende Medienpräsenz).
Ein Europäisches Literaturhaus R-u-h-r hätte die junge Literatur, die Verlage und Literaturzeitschriften aus dem Ruhrgebiet (etwa den Grafit und Klartext Verlag oder das ‚Schreibheft‘) in gelungenen Veranstaltungen sozusagen in einer Art „Schaufenster nach außen“ auch bundesweit zu präsentieren. Parallel dazu würde internationale Literatur gleichsam über ein „Schaufenster nach innen“ vorgestellt.
Ein Europäisches Literaturhaus R-u-h-r wäre kein Allheilmittel gegen alle Defizite des literarischen Lebens im Revier, aber es könnte genau die Initialzündungen auslösen, die nötig wären, um eine lebendigere literarische Szene im Ruhrgebiet entstehen zu lassen und damit vielleicht auf Dauer auch mehr Autoren, Verleger und Medien ans Revier zu binden. Zurzeit wandern viele große Talente noch nach Berlin und anderswo ab, kaum ein Autor von Rang läßt sich dagegen im Ruhrgebiet nieder.
Binden und fesseln durch Abenteuer für den Kopf
Zudem: Auch das Publikum will gepflegt werden. Nicht nur die Folkwang-Hochschule oder Schauspielhäuser wie das Bochumer Theater oder das Theater an der Ruhr, auch die Einrichtungen der soziokulturellen Szene haben in der Vergangenheit deutlich gemacht, wie wichtig Treffpunkte, feste Einrichtungen für die Entwicklung der (klein-)künstlerischen Szene und die Herausbildung eines dazugehörenden Publikums sein können.
Ein Europäisches Literaturhaus R-u-h-r sollte zwar einen Sitz haben, ein Domizil mit angemessenen Veranstaltungs- und Büroräumen, gleich ob nun in einer Villa, einem Industriekultur-Gebäude oder im Rahmen eines attraktiven Innovations- oder Gründerzentrums, aber es dürfte als Europäisches Literaturhaus R-u-h-r keinesfalls nur dort tätig sein.
Das Ruhrgebiet braucht ein LITERATURHAUS als regionalen Veranstalter, als Agentur, als Markenzeichen, als Mittelpunkt eines Literaturnetzes Ruhr. Das Europäische Literaturhaus Ruhr hätte als Literaturhaus auch in der Region Veranstaltungen durchzuführen. Unter dem Titel „Das Europäische Literaturhaus Ruhr zu Gast in …“ könnten Autoren, Diskussionen, interdisziplinäre Kunst-Projekte (zum Beispiel) im Landschaftspark Duisburg-Nord, im Gasometer Oberhausen, in der Zeche Zollverein usw. durchgeführt werden. Nicht zuletzt deshalb, um das Publikum in der Region auf das Mutter-Literaturhaus aufmerksam zu machen und es fest daran zu binden.
Die leidigen Finanzen
Allerdings hätte ein solches Europäisches Literaturhaus Ruhr auch seinen Preis. Karge Zuschüsse, halbherzige personelle und materielle Förderung wie etwa die für das engagierte Literaturbüro Ruhr e.V. verweigern von vornherein die finanzielle Mindestausstattung für dauerhaften internationalen Literaturaustausch und ein professionelles Kulturmanagement, das nicht nur auf Kosten der Mitarbeiter ginge. Hohe Kompetenz der Mitarbeiter allein kann kein erfolgreiches Europäisches Literaturhaus Ruhr begründen. Der kulturpolitische Wille zu profilierter regionaler Literaturpolitik mit bundesweiter und internationaler Ausstrahlung, der Wille zur Bündelung der Kräfte ließe sich nur umsetzen, wenn endlich auf solider materieller Grundlage hochkarätige Literaturförderung in der Region betrieben werden könnte.
Wer ein Netz knüpfen will, darf die Knoten nicht vergessen
Noch einmal: Es gibt ein reges literarisches Feld im Ruhrgebiet, es gibt bereits ein Netz engagierter, aber oft isolierter Autoren, Vermittler, Förderer, Vereine und Institutionen. Was uns fehlt, sind belastbare Knotenpunkte. Ein Literaturhaus gäbe als ein solcher Knotenpunkt diesem oft noch zu wenig sichtbaren Literaturnetz mehr Halt. Sagen wir aber nichts gegen dieses Netz der Enthusiasten, fordern wir nur ein anderes, ein besseres, das in dieser „großen Großstadt Ruhr mit seiner immer stärker werdenden sozialen Polarisierung“ (Prof. Strohmeier, ZEFIR) das geistige Leben selbstbewusst weiterentwickeln hilft.
(Dieser aktualisierte Vorschlag zu einem Europäischen Literaturhaus Ruhr erscheint zeitgleich auch auf der Homepage des Literaturbüros Ruhr.)