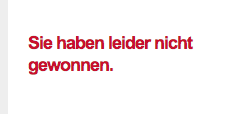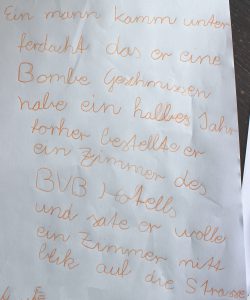Und, wonach greifen Sie nach dem Aufwachen zuerst? Nun gut, es gibt vielleicht ein Küsschen für den Menschen neben uns. Aber dann schnappt man sich dieses kleine flache Gerät, das, neben einem einstaubenden Rilke-Band, auf dem Nachttisch liegt. Hat es nicht gerade so vertraut gebrummt?

Die Zukunft hat offenbar schon begonnen… Vielsagender Moment beim Science-Fiction-Treffen im Technikmuseum Speyer. (© Franz Ferdinand Photography) Photo credit mit Links: Franz Ferdinand Photography Science Fiction Treffen via photopin (license)
Hallo, du mein Wecker voller Musik, mein Telefon, meine Verbindung zur Welt, mein Minikino, mein Alleswisser, mein Immerfürmichda-Dings! Guten Morgen! Magst du mal eben meinen Puls fühlen? Natürlich, das kannst du auch, mein süßes Roboterchen. Denn wir leben unter Bedingungen, die in der Rock’n’Roll-Ära noch pure Science-Fiction waren. Hilfe, die Zukunft ist da!
Es soll sie ja geben. Ein paar ältere Herrschaften, die sich der neuen Technik verweigern. Sie haben kein Smartphone, sie kennen kein Internet: „Brauch ich nicht, will ich nicht“, murren sie. Doch sie kennen ihre Fernbedienung und lassen gerne ganztägig den Fernseher laufen. Früher flimmerte da ein Testbild, jetzt ist immer Seifenoper. Blöd, aber faszinierend.
Genau so etwas hatten wir befürchtet, damals, als wir den Fortschritt noch mit Skepsis sahen. Aber zum Glück gibt es – zumindest in der westlichen Zivilisation von Angela Merkel und Monsieur Macron – keinen dämonischen Staatsapparat, der uns dumm hält, um uns für fiese Ziele zu benutzen, was Dichter, Denker und wir Gelegenheitsrevoluzzer stets geargwöhnt hatten. Es ist vielmehr die betörende Technik, diese geschäftstüchtige Circe des 21. Jahrhunderts, die uns mit ihrem Zauberkünsten und Lockgesängen in ihren Bann gezogen hat. Und wir wollen uns nicht mehr von ihr trennen.
Captain Kirk, bitte kommen!
Denn sie macht uns das Leben schon sehr bequem. Wir müssen nie mehr wieder nach einer Telefonzelle suchen, nach Münzen kramen und uns über zerfledderte Telefonbücher ärgern. Unser Smartphone kennt sowieso alle Nummern, stellt jederzeit und überall die Verbindung her. Selbst aus der Gletscherspalte können wir noch Mutti anrufen, denn das Mobilfunknetz umfasst entlegenste Winkel der Erde. Und Akkus halten auch immer länger.
Tatsächlich funktionieren unsere Handys heute reibungsloser als der Kommunikator, mit dem Captain Kirk in der Fantasie von 1966 Kontakt zu den Kollegen vom Raumschiff Enterprise aufnahm. Ein ziemlich klobiges Klappding war das – und doch vollkommen utopische Technik für Menschen, die allenfalls ein knarrendes Walkie-Talkie kannten.

Allgegenwärtiger Begleiter: das Smartphone. (Foto: Joachim Kirchner / pixelio.de)
1966, das muss man mal bedenken, war noch nicht einmal das Fax-Gerät erfunden, das sich die Enterprise-Macher ausgedacht hatten. Wer hätte damals geahnt, dass auch das Bildtelefon mit beliebiger Projektion – dolle Sache in der Sternenflotte – für uns alle bald schon eine Selbstverständlichkeit werden würde? Gerade so, wie Captain Kirk und sein geschätzter Halbvulkanier Mr. Spock (der mit den spitzen Ohren) die knurrenden Klingonen-Generäle vor dem Zusammenstoß auf ihren Schirmen sehen konnten, gucken wir heute der Schwiegermutter über Skype in die Augen. Und dank Highspeed Flatrate kostet das nichts extra.
Das Ende der Geheimnisse
Die ewige Verfügbarkeit kann auch ein Fluch sein. Es gibt keine Ausreden mehr. Vorbei die Zeit, als man tatsächlich in die Ferien verschwinden konnte – mit dem vagen Versprechen, nach einer Woche vielleicht einmal anzurufen („Aber verlass dich nicht drauf …“). Ständige Statusmeldungen – „Sind jetzt am Autobahnkreuz“, „Haben die Meiers getroffen“, „So sieht der Strand aus“ – gehören zum Unterwegs-Sein. Und es werden zeitnahe Antworten erwartet. Schließlich verpetzt mir meine What’sApp sofort, wann die Lieben meine Nachricht gesehen haben.
Diskretion war gestern. Finstere Mächte, geheime Dienste könnten jede meiner Mails und Messages theoretisch auch gesehen haben. Da nützen Anti-Viren-Programme nichts. Wir wissen alle, dass die gründliche Bespitzelung des Einzelnen technisch kein Problem mehr darstellt. Genau das hat George Orwell, der alte Pessimist, in seinem 1948 vollendeten, von der Zeit überholten Zukunftsroman „1984“ befürchtet.
„Big Brother is watching you“ – ja, ja, der wie auch immer geartete große Bruder kann/könnte alle Räume und Straßen beobachten, unsere Gespräche abhören, unsere Handys und Autos jederzeit orten. In den 1970er-Jahren wären wir ausgeflippt vor Entsetzen. Heute ist die Privatsphäre ein weniger streng gehütetes Revier.
Keine Angst vor Big Brother
Mit kindlichem Vergnügen geben wir der Öffentlichkeit bei Facebook preis, wo wir heute Abend essen gehen, was wir auf dem Teller haben, wie süß der Hund wieder guckt. Die virtuellen Friends verdrehen schon die Augen, treiben es aber ähnlich. Ich poste, also bin ich, das ist die Devise der Social-Media-Gesellschaft.
Während die Vorsichtigen wenigstens kurz überlegen, was sie da unauslöschbar in die Welt setzen, so begeben sich tollkühne oder auch dummdreiste Freiwillige in die Arenen der Reality-Shows, scheuen weder Dschungelprüfungen noch Wohnzimmerknäste und lassen sich vor der Kamera demütigen. Eigentlich nicht zu fassen: Orwells Begriff vom „Big Brother“ ist seit der Jahrtausendwende der Titel der erfolgreichsten Sendung mit voyeuristischem Konzept.
Verzeihen Sie, Mr. Orwell, der Sie die Menschheit mit dem gruseligen Großen Bruder vor dem faschistoiden Überwachungsstaat warnen wollten! Wir Science-Fiction-Wesen haben aus Ihrem düsteren Zukunftsbild einen Witz gemacht. „Wir amüsieren uns zu Tode“, ermahnte schon in den 1980er-Jahren der Medienwissenschaftler Neil Postman die Welt. Aber wir leben noch, trotzen dem Terror und der Klimakatastrophe und gucken jetzt Serien gleich staffelweise auf Netflix. Unsere Empfindlichkeiten haben sich offenbar erheblich verändert. Die nicht abschaltbaren Teleschirme in Orwells 1984er-Szenario können uns einfach nicht mehr schrecken.
Seltsame neue Welt
Natürlich regen wir uns zwischendurch mal ein bisschen auf – über Gentechnik, Leihmütter, eingefrorene Eizellen, Embryonen aus dem Reagenzglas und geklonte Tiere. Lauter Phänomene aus der klassischen Science-Fiction-Literatur, die mir nichts, dir nichts Wirklichkeit geworden sind.
Immer wieder gern zitiert wird in diesem Zusammenhang der 1932 entstandene Zukunftsroman „Schöne neue Welt“ des britischen Intellektuellen Aldous Huxley. Noch heute beschäftigen sich artige Abiturienten mit dem pädagogisch konstruierten Stoff über einen globalen Staat, der die Menschheit in Großlabors aufzieht und perfekt kontrolliert. Für Vergnügungen ist gesorgt, allzu starke, individuelle Gefühlsregungen sind hingegen unerwünscht und werden von der Obrigkeit gewaltsam unterdrückt.
Da allerdings irrten Huxley und andere Vordenker. Es ist alles noch viel raffinierter. Wir in der Zukunft Angelangten dürfen durchaus individuell fühlen und handeln. Das allumfassende Netz bietet uns nicht nur ständige Konsum-, Kommunikations- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Nein, es nimmt auch unsere Wutausbrüche und Verschwörungstheorien offenherzig entgegen, Tag und Nacht.
Liebesschwüre und Hasstiraden werden genauso tolerant gespeichert und leidenschaftslos verbreitet wie Referate über die Erderwärmung. Und was das Beste ist: Das System hilft uns bei dem Referat. Wie eines dieser allwissenden Elektronengehirne aus der Science-Fiction-Literatur weiß es Antworten auf alle Fragen. Gefüttert vom Wissen zahlloser einander kontrollierender Individuen, entwickelt es zum Glück (noch) kein gemeines Eigenleben wie der Supercomputer HAL 9000 aus Stanley Kubricks 1968er-Werk „2001 – Odyssee im Weltraum“. Aber das kann ja noch kommen.
Wo bleibt das eigene Wissen?
Bisher lieben wir unser allwissendes Elektronengehirn und googeln uns durchs Leben, auch wenn uns hin und wieder ein Unbehagen beschleicht. Was ist, wenn der große Stecker mal gezogen wird? Wenn die iCloud, diese mysteriöse Datenwolke der weltbeherrschenden Firma Apple, vom Wind des Unberechenbaren verweht wird? Wenn die Systeme kollabieren? Dann, werte Mitmenschen, bleibt, was derzeit nicht mehr allzu heftig gefördert wird: das eigene Wissen. Wohl dem, der dann noch Meyers Taschenlexikon in 25 leider veralteten Bänden besitzt! Das sind bekanntlich nur wenige Menschen.
Die Vernichtung der privaten Bibliotheken musste keineswegs, wie in Ray Bradburys 1953 erschienenem Science-Fiction-Roman „Fahrenheit 451“, mit Gewalt betrieben werden. Junge Leute schleppen sich bei ihren globalen Umzügen nicht mehr mit 100 Bücherkisten ab. Große Bücherwände sind aus den Katalogen der Möbelhäuser verschwunden. Zwar kaufen kultivierte Damen gerne Literatur zum Verschenken. Auch sieht man im Urlaub Leute mit Krimis auf dem Liegestuhl. Aber auf Dauer ist das e-book nun mal praktischer.
Alles ist so praktisch. Wir können über das Smartphone zu Hause das Licht anmachen. Wir müssen uns keine Zahlen und Fakten mehr merken. Das Auto fährt bald von selbst. Und schon jetzt führt uns das Navigationssystem zu jedem Ziel, das wir uns vorher über Streetview schon mal angeguckt haben. Wir müssen nicht mal mehr mit dem Finger auf Tasten drücken. Die Technik reagiert auch auf unsere Stimme.
Science-Fiction ist Realität geworden. Es wird Zeit, den eingestaubten Rilke-Band vom Nachttisch zu nehmen und mal wieder einfach so auf knisterndem Papier ein Gedicht zu lesen: „Wenn es nur einmal so ganz stille wäre …“. Dann denken wir noch mal nach. Über uns und die Zukunft, in der wir angekommen sind.