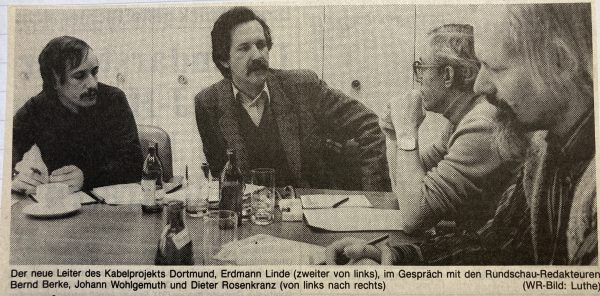Dem Zeitgeist hinterhergerannt – Werke von Bernhard Hoetger in Dortmund
Von Bernd Berke
Dortmund. Wohl wenige aus dem Dortmunder Raum stammende Künstler dürften so sichtbare Zeichen ihres Wirkens gesetzt haben wie Bernhard Hoetger. Wer, bitte?
Bernhard Hoetger, am 4. Mai 1874, also vor 110 Jahren, im damals noch selbständigen Ortsteil Hörde geboren, Lehrjahre in Paris, Hauptwirkungsstätten Darmstadt und Worpswede/Bremen. Hoetger entwarf nicht nur die Bauten in der Bremer Böttcherstraße oder das „Cafe verrückt“ in der Künstlerkolonie Worpswede; um ein Haar wäre nach seinen Plänen auch noch Deutschlands erste und einzige „äyptische Stadt“ gebaut worden – im Auftrag des Keksfabrikanten Bahlsen, dessen Tod (1919) das monströse Projekt einer Arbeitersiedlung im Pharaonenstil allerdings scheitern ließ. Den Architekten, Designer und vor allem den Bildhauer Hoetger stellt jetzt das Ostwall-Museum mit einer Werkschau vor. Erstmals wird dabei auch der Nachlaß gezeigt, der 1962 in städtischen Besitz überging (bis 13. Mai, Katalog 24 DM).
Wer fast sämtliche Kunststile bis zur Mitte des 20. Jahrhunlerts nachgeahmt sehen möchte, der gehe jetzt ins Ostwall-Museum. Hoetger hat sich nach und nach – offenbar wahllos – Stilrichtungen „einverleibt“. Am Anfang stehen Einflüsse Rodins, dann dominieren Vorlieben für ägyptische, afrikanische, ostasiatische, gotische und expressionistische Kunstauffassungen. Die Ergebnisse haben nie unverwechselbare Gestalt; sie sind lediglich mal nah am Zeitgeist, mal weit von ihm entfernt. Wie abwegig Hoetgers Entwürfe gerieten, wenn sie sich auf keinen fremden Stil stützten, zeigt sein nichtssagendes Berliner Alterswerk.
In den 20er Jahren entstanden allerdings Werke, die sich annähernd auf der Höhe ihrer Zeit befanden: Möbel im Art Deco-Stil oder Plastiken, die, eigenartigerweise auf dem Wege der Beschäftigung mit afrikanischer Kunst, in Richtung „Neue Sachlichkeit“ wiesen. Doch Nachahmung – und das dokumentiert diese Ausstellung nachhaltig – hat Schattenseiten: Bemerkenswertes steht neben Unsäglichem. Damit ist nicht nur der „Schweinehund als Tischfeuerzeug“ gemeint, den man notfalls noch als witzige Kuriosität à la Dada durchgehen lassen könnte. Geradezu prekär ist Hoetgers Anpassung geworden, als die Nazis die Macht erschlichen. Hitler wollte das von Hoetger konstruierte Portal der Böttcherstraße abreißen lassen. Hoetger entfernte das mißliebige Dekor und ersetzte es durch eine Drachen-Szene im Dutzendstil.
_____________________________
Leserbrief: „Schnoddrige Polemik“
Sehr geehrter Herr Berke, ich bekomme erst jetzt Ihren Artikel über die Hoetger-Ausstellung im Museum am Ostwall in die Hand. So haben da nicht bloß mit schnoddriger, sondem auch mit böswilliger Polemik gearbeitet. Jedenfalls zeigt Ihr Text doch wohl, daß Sie über Entwicklungsvoränge bei Künstlern nicht besonders unterrichtet sind. Hoetger war, und das liegt in seiner Zeit, zu einer – suchenden – Existenz verureilt. Wenn einer sich bloß anpaßte, konnten niemals solche Qualitäten entstehen – die in vielen seiner Werke doch wohl unbestritten vorhanden sind. Nicht in allen – klar.
Jedenfalls kommt es mir so vor, als ob Sie sich in erster Linie spektakulär profilieren wollten – und nicht daran gedacht haben, daß die Stadt Dortmund (der ich sehr verbunden bin) in Sachen bildender Kunst doch eine starke Grauzone ist. Da wäre eher mit sachlicher Aufklärung gedient – die selbstverständlich auch Kritik beinhalten sollte.
Eva Niestrath-Berger, 58 Hagen-Helfe