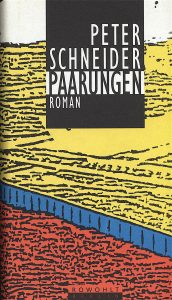Eduard und die Liebe zu Frauen und Mäusen – Peter Schneiders amüsanter Roman „Paarungen“
Von Bernd Berke
Eduard ist Naturwissenschaftler, also rechnet er nach: Im statistischen Schnitt ist eine Liebesbeziehung in seiner Generation „nach drei Jahren, einhundertsiebenundsechzig Tagen und zwei Stunden“ vorbei.
Eduard ist aber auch eine Spielernatur. Also wettet er mit seinen Kumpanen aus der Szenekneipe „tent“, Theo und André: Wer hält wohl am längsten mit seiner jetzigen Freundin durch? So kommt Peter Schneiders Roman „Paarungen“ in munteren Gang – und führt durch herrlich-schreckliche Liebes-Labyrinthe. Denn es bleibt nicht bei der strengen Monogamie.
Im ganzen Roman wirkt ein „Spaltpilz“. Diesen Namen bekommt eine mysteriöse Figur, die immer mal wieder durch die Handlung geistert und vom Nachtseiten-Romantiker E. T. A. Hoffmann stammen könnte. Zudem spielt das Buch im noch gespaltenen Berlin – und dort grassiert der Trennungsvirus, der jede Liebe kleinkriegt, ganz besonders heftig.
Groteske Balance zwischen Freiheit und Bindung
Peter Schneider seziert die vermeintlich ach so freien und in Wahrheit doch so verkorksten Lebensformen der alten „68er“-Rebellen mit haarfeiner Ironie, ohne seine Personen menschlich zu denunzieren. Sie sind ja in wirklichen Nöten. Und doch ist es auch zum Lachen. Die Liebeshändel jener Leute, die heute so etwa zwischen 40 und 50 sind, enden in grotesken Balanceakten zwischen Freiheit und Bindung. Am Ende geht man fast so verdruckst fremd, wie es die verhaßten Väter einst getan haben.
Auch politisch ist man {schon vor der DDR-„Wende“) mächtig ins Trudeln geraten. So ist etwa Eduard im Bio-Labor dem Erreger der Multiplen Sklerose auf der Spur, träumt schon vom Nobelpreis und braucht nur noch eine einzige Versuchs-Maus, die er – als sei’s eine Figur von Goethe – zärtlich „Lotte“ nennt; wie denn überhaupt auch der Name Eduard auf Goethe verweisen könnte. Doch zurück zur Maus: Der vormals ungebrochen „Linke“ ist überaus entsetzt, als studentische Öko-Anarchisten das liebe Tierchen befreien. Wie er da plötzlich die Jugend und ihren missionarischen Eifer haßt! Und wie da eine Sehnsucht nach Einvernehmen mit seinen Eltern aufkommt! Das wiederum bringt die ganze schöne und früher so glasklare Sicht auf die Zeit des Faschismus durcheinander.
Handlinie mit zwei verräterischen Abzweigungen
Doch vor allem gerät Eduard in die erotische Mangel. Es tritt genau das ein, was eine bulgarische Handleserin ihm prophezeit. Seine Liebeslinie mit zwei Abzweigungen bedeutet: erwiderte Zuneigung zu drei Frauen. Die heißen Klara, Jenny und Laura. Und obwohl Eduard doch laut Laborbefund fast zeugungsunfähig sein soll, sind plötzlich zwei von ihnen schwanger – und die dritte, ehedem seine „Feste“, ist tödlich beleidigt.
Eduards Kumpanen es nicht viel besser. Eigentlich haben sie alle ihre Wette verloren. Mitunter kommen sie sich – fast der Labormaus vergleichbar – wie Versuchspersonen in einem großen Liebesexperiment mit ungewissem Ausgang vor. Eine ganze Generation, so eine Essenz der Geschichte, versagt vor den großen, dauerhaften Gefühlen. Und doch: So ganz tot ist auch die Utopie von einer lebbaren Mehrfach-Liebe ohne Ausschließlichkeit noch nicht.
Man findet in diesen Jahren nur selten deutsche Romane, die etlichen Tiefgang und Amüsement, die Zeit- und Seelenschau so unangestrengt verbinden. Klug gewählt hat Schneider Eduards Biologen-Beruf. Das bringt nämlich eine weitere Stärke des Autors ins Spiel: die essayistische Form. So sind seine Überlegungen zum Verhältnis von Naturwissenschaft und Gesellschaft schon für sich lesenswert. Und er hat sie so stilsicher in den Romanverlauf eingefügt, daß sie gar nicht wie Fremdkörper wirken.
Peter Schneider: „Paarungen“. Roman. Rowohlt Berlin, 345 Seiten, 38 DM.