„Darüber reden“: Julian Barnes schickt drei Menschen auf den Markt der Liebe
Von Bernd Berke
Ein Mann heiratet. Dann spannt ihm sein bester Freund die Frau aus und ehelicht sie seinerseits. Kein weltbewegendes Geschehen, wenn man es kühl betrachtet.
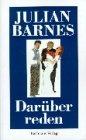 Doch kann ein solcher Vorgang bekanntlich die größten Bestürzungen auslösen. Dann wird man vielleicht fieberhaft dies tun: „Darüber reden“. So heißt das neue Buch von Julian Barnes, einem Autor, der seit „Flauberts Papagei“ und „Eine Geschichte der Welt in zehneinhalb Kapiteln“ auch bei uns immer stärker beachtet wird.
Doch kann ein solcher Vorgang bekanntlich die größten Bestürzungen auslösen. Dann wird man vielleicht fieberhaft dies tun: „Darüber reden“. So heißt das neue Buch von Julian Barnes, einem Autor, der seit „Flauberts Papagei“ und „Eine Geschichte der Welt in zehneinhalb Kapiteln“ auch bei uns immer stärker beachtet wird.
Auf 263 Seiten breitet Barnes die Liebeswehen seiner Figuren aus. Alles in direkter Rede, so als sprächen die handelnden/erleidenden Personen den Leser direkt an, als bäten sie ihn um „objektive“ Zeugenschaft und Beistand. Oder wenden sie sich gar an eine Art „höhere Instanz“, die ein Urteil sprechen soll? Jedenfalls fühlt man sich sofort aufgenommen in den kleinen Kreis, man wird sogleich ins Vertrauen gezogen.
Barnes weiß eben sehr, ja beinahe zu gut, wie man Leser ködert. Er schreibt hinreißend, überrollt einen geradezu mit seinem Stil, der gleichsam perlt und prickelt. Da erzählt einer ebenso „süffig“ wie etwa John Irving.
Die drei Hauptpersonen: Stuart, ein stocksteifer Bankmensch; sein Freund Oliver, genialischer Hallodri – und das Objekt ihrer gemeinsamen Begierde, die Gemälde-Restauratorin Gillian. Barnes deutet an: So wie Gillian verborgene Schichten alter Bilder sichtbar macht, so kehrt die Liebe nach und nach immer andere Schichten der Persönlichkeit hervor.
Alle drei reden ganz verschieden und wandelbar. Stuart wirkt zunächst tapsig und naiv, dann kommen seine unterdrückte Wut und sogar Durchtriebenheit zum Vorschein. Oliver steigert sich eingangs in selbstverliebte Sprachräusche, wird aber kleinlaut, als er sich in Gillian verliebt. Und Gillian redet am Anfang ganz knapp und nüchtern, bevor sie sich zunehmend erhitzt.
Der Leser weiß immer etwas mehr als dieses Trio (zumal weitere Personen ihn mit Zusatzinformationen versorgen) und kann mit einer Mischung aus Besorgnis und Vergnügen ihre seelischen Irrungen und Wirrungen verfolgen: Drei Helden des Alltags, gesegnet und gepeinigt mit dem ganzen Plunder des menschlichen Innenlebens. Auch wenn rings die Computer blinken und alles voraus“ berechnen – in der Liebe ist ja bisweilen jede(r) hilflos wie ein Kind.
Ein Buch ohne „Moral“. Zwar dreht es sich auch um solche Fragen: Was kann die Ehe heute noch bedeuten? Ist wirkliche Liebe zu dritt oder viert möglich? Wie steht es mit dem Verhältnis von Liebe, Sex und Geld? Doch das ganze Geschehen „dreht“ sich halt wie ein Karussell, spielerisch und bunt. Wenn man denn schon Essenzen aus diesem Buch ziehen will, so könnten sie etwa so lauten: Weder gegen die Liebe noch gegen ihren Verlust vermag man etwas.
Endlos könnte man eben „darüber reden“, wie sie einen gnadenlos erwischt und verläßt. Zu Zeiten hitzig – und doch im Grunde tief ernüchtert. Denn offenbar folgen ja all unsere‘ Gefühle nur den grausamen Konkurrenz-Gesetzen eines Marktes…
Staunenswert die Übersetzung. Hier hat man den nicht gar so häufigen Fall, daß ein fremdsprachig verfaßtes Buch so frisch klingt, als sei es gleich auf Deutsch geschrieben worden.
Julian Barnes: „Darüber reden“. Aus dem Englischen von Gertrude Krueger. Haffmans Verlag. 263 Seiten. 36 DM.