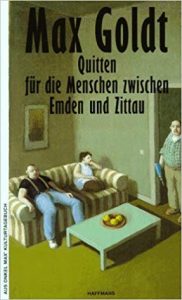Puppenbild am Beichtstuhl, Krücken an den Wänden – Kunst kehrt in die Kirche zurück
Von Bernd Berke
Münster. An die Wände der Lambertikirche hat jemand lauter Krücken gestellt. Im selben Gotteshauses hängt, gleich neben dem Beichtstuhl und scheinbar höchst unpassend, ein im „wilden“ Stile gemaltes Bild, auf dem Kinder mit einer zerstörten Puppe zu sehen sind. Und in der Überwasser-Kapelle hat sogar einer die Wände vollgeschrieben. Welche Frevler waren da am Werk?
Gar keine. Es geht um eine Aktion, mit der in Münster das schwierige Verhältnis zwischen Kunst und Kirche ausgelotet wird. Seit Maler und Bildhauer in die Abstraktion abgewandert sind, fanden Amtskirche und praktizierende Christen die Werke nicht mehr anschaulich genug – und damit untauglich zur Glaubensvermittlung.
Bis zum 18. Jahrhundert schienen Kunst und Kirche verschwistert, dann riß die Verbindung zusehends. Hinter dem Münsteraner Projekt „Gegenbilder“, das Arbeiten von 13 Künstlern in vier Kirchen versammelt, stehen Vertreter der beiden großen christlichen Konfessionen als Beiräte. Für die Auswahl war der Galerist und Kunstvermittler Eberhard Lüdke zuständig: „Anfangs bin ich auf Widerstand gestoßen“, bekennt er. Doch Gespräche mit den Gemeindevorständen hätten manches Mißtrauen beseitigt. Ein Begleitprogramm soll nun das Thema vertiefen. Die Kirchenbesucher werden mit Hinweistafeln eingestimmt.
Ein geschlossenes und ein allseits offenes System
Lüdke zum Kern des Problems: „Die Kirche ist ein eher geschlossenes System, die Kunst ein allseits offenes. Das erzeugt Reibung.“ Die Kunst richte ihr Augenmerk eben auf die Zersplitterung der Welt, die Kirche auf den großen Zusammenhang. Desto mehr war Lüdke überrascht, wie bereitwillig die Künstler mitwirkten; geradezu, als hätten sie auf den Anstoß gewartet und als habe das Thema in der Luft gelegen.
Auch bekanntere Größen wie Stephan Balkenhol und Tony Cragg sind dabei. Sie fertigten ihre Arbeiten eigens für Münster an, um auf räumliche Gegebenheiten einzugehen. Mischa Kuball bedient sich der Bildprojektion, Jan van Munster verpaßt dem Steinfußboden irritierende Muster, Stephan Balkenhol hat zwei nackte Holzfiguren geschnitzt: Adam und Eva. Mark Formarek stellt einen Automaten auf, der auf Knopfdruck Trostworte spendet, und Dieter Kießling hat einen Kunst-Brunnen ans Taufbecken platziert.
Norbert Rademacher stellte die erwähnten „Krücken“ auf, die sich ästhetisch in die Säulen-Ordnung der Kirche einfügen. Es sind Pilgerstöcke, also keineswegs unchristliche Gegenstände. Überhaupt ist das Wort „Gegenbilder“ nicht als Attacke zu verstehen, sondern im Sinne eines behutsam-kritischen, freundlich gestimmten Gegenübers. Ganz klar: Ausgesprochene Kirchenfeinde oder Tempelstürmer wurden gar nicht erst eingeladen.
Fragt sich, was geschieht, wenn die Ausstellung vorbei ist. Möglich, daß etwa die Schriftzüge in der Überwasserkirche übertüncht werden. Möglich auch, daß es hier und da zu Ankäufen kommt. Welche Gemeinde hat Mut?
„Gegenbilder“. Münster (Apostel-, Dominikaner-, Lamberti- und Überwasserkirche). Bis 31. Oktober, tägl. 10-18 Uhr. Katalog 20 DM. Infos/Führungen 0251/25687.