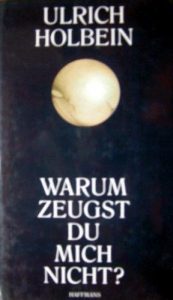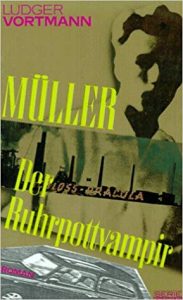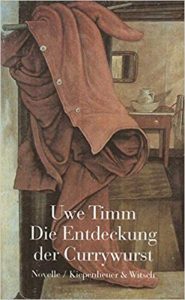In der Bundesliga des Theaters spielt das Ruhrgebiet nicht mit
Von Bernd Berke
Allherbstlich wird sie mit Spannung erwartet: die Jahresumfrage des Magazins „Theater heute“. Welche Sprechbühnen gehören in die „Bundesliga“, wer steigt ab, wer steigt auf? Geht es nach dem Urteil der befragten 40 Kritiker, so war es in der letzten Saison um die Theater des Ruhrgebiets so schlecht bestellt wie lange nicht mehr.
Zwar verteilt man bei „Theater heute“ noch keine symbolischen Masken wie Kochlöffel, doch man ist der Hitlisten-Manie immerhin so weit verfallen, daß man arglos „Die Sieger“ ausruft. Bester Schauspieler: Jürgen Holtz (keineswegs nur als „Motzki“); beste Schauspielerin: Kirsten Dene (an Peymanns Burgtheater); bester Regisseur: Luc Bondy. Frank Castorfs Berliner Volksbühne steht als „Theater des Jahres“ auf Platz eins. In dieser Rubrik (Gesamtleitung einer Bühne) mochte nur noch ein Unverdrossener überhaupt ein Revier-Theater nennen – ein einsames Stimmchen erhebt sich für Roberto Ciullis Mülheimer Theater an der Ruhr. Das war’s dann auch schon.
Ansonsten taucht die Region nur mit ganz wenigen Einzelleistungen auf. In der Sparte „Beste Inszenierungen“ wird, als revierweit einzige, immerhin viermal Jürgen Goschs Bochumer Handke-Einrichtung „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ nominiert. Die Tat eines Gastregisseurs also, während man z.B. den Namen des Bochumer Noch-Schauspielchefs Frank-Patrick Steckel vergeblich sucht. In Sachen Bühnenbild/Kostüme werden immerhin Andrea Schmidt-Futterer, Dieter Hacker und Kazuko Watanabe für Bochumer Produktionen erwähnt.
Noch finsterer sieht es offenbar bei den Schauspielern aus. Nur ein Name aus dem gesamten Ruhrgebiet taucht überhaupt auf, und auch das nur einmal: Matthias Kniesbeck (als „Othello“ in Oberhausen).
Gnädigerweise hat man das Revier wenigstens in der Spalte „Beste/r Nachwuchskünstler/in“ nicht ganz vergessen. Und hier ist denn auch, neben der Bochumer Schauspielerin Judith Rosmair, endlich und erstmals Dortmund vertreten, freilich durch die Regisseurin Amelie Niermeyer (für ihre „Lysistrata“), die man leider längst nach München hat ziehen lassen.
Tja, warum ist Frau Niermeyer wohl an die Isar gegangen? Wohl auch, weil sie dort überregional eher wahrgenommen wird als in Dortmund. Denn die Nichtberücksichtigung im Jahrbuch von „Theater heute“ hat nicht immer mit Mangel an Qualität zu tun, sondern vielfach damit, daß die 40 Kunstrichter die Abstecher gescheut haben. Sprich: Was sie nicht kennen, können sie auch nicht nennen. Was bleibt? Immerhin zwei Zukunftshoffnungen: die kommende Ära Leander Haußmann in Bochum und Jürgen Bosse in Essen.