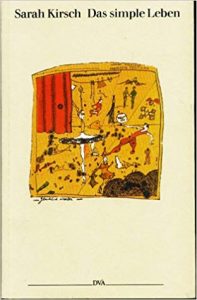Im Drahtgeflecht steckt der Protest – Arbeiten des Spaniers Manuel Rivera im Museum Folkwang
Von Bernd Berke
Essen. Die entscheidende Idee für seine Kunst kam dem Spanier Manuel Rivera in einer ganz alltäglichen Situation: beim Blick in ein Schaufenster.
Da schwebten Werkzeuge hinter der Glasscheibe, als hätten sie fliegen gelernt. Von außen konnte man überhaupt nicht erkennen, daß sie drinnen an dünnen Drähten aufgehängt waren. Derlei Sinnestäuschung prägt seither die Arbeiten des 1927 in Granada geborenen Künstlers. Auch dem Material Draht hat er sich seitdem verschrieben. Auf seinen Bildobjekten kehrt es in Form von filigranen Geflechten, Verzweigungen und Spannkräften wieder. Das Essener Folkwang-Museum zeigt jetzt 85 Exponate aus den Jahren 1956 bis 1966, die Rivera selbst für seine wichtigste Phase hält.
Damals herrschte in Spanien die Franco-Diktatur. Es war schon ein Wagnis, als sich Rivera im Jahr 1957 mit anderen Künstlern zur maßvoll oppositionellen Gruppe „El Paso“ (Der Schritt) zusammenschloß. Als sie 1958 bei der Biennale in Venedig Furore machten, wollte Franco sie geschickt als Repräsentanten des Landes vereinnahmen, was 1960 zur Spaltung und Auflösung der Gruppe führte.
Verborgene Strukturen vergegenwärtigen
Rivera und andere begriffen seine abstrakten Objekte als widerständige Kunst. Freilich ist es ein Aufbegehren in Andeutungen, keine offene Rebellion, die damals gefährlich gewesen wäre. Die Serie der „Metamorphosen“ setzt nicht nur im Titel das Prinzip des Wandels jedwedem starren System entgegen.
Diese Kunst verlangt keine Andacht, sondern ganz konkrete, körperliche Schritte. Denn wenn man vor diesen Werken still stehen bleibt, bemerkt man nur die pure Oberfläche. Erst durch Bewegung des Betrachters erschließt sich die eigentliche Qualität. Dann beginnen die voreinander gespannten Metallgitter auf den zumeist verwaschenen Farbfeldern ein seltsames Flirren und rätselhafte Licht-Spiegelungen freizusetzen. Die zweite Langzeit-Serie trägt denn auch den Obertitel „Espejos“ (Spiegel).
Man verspürt vor diesen Arbeiten eine unaufhörliche Unruhe, Ungewißheit, Nervosität. Es sind elastische Bilder, Bilder der Veränderung, nicht der Zustände.
„Damals waren es Schreie…“
Die Draht-Verspannungen lassen zudem vage Gedanken an Zwang, Fesselung oder gar Folter aufkommen. Gelegentlich verdichten sich diese Zeichen zu verqueren Knebelstellen und Knotungen unter Verwendung von Stacheldraht. Spanische Ausstellungsbesucher werden damals wohl geahnt haben, worum es ging. Ein mögliches Lehrstück mithin: Auch abstrakte Kunst, die die Dinge nicht direkt zeigt, sondern ihre verborgenen Strukturen vergegenwärtigt, kann Widerstand sein und vielleicht wecken.
Riveras Anfänge weisen ins Informel zurück, er gehörte jedoch nie der heftig-gestischen Fraktion dieser Richtung an. Der widerspenstige Draht verhindert ein spontanes Sich- Ausleben auf der Bildfläche, er will bedachtsam gebogen und geflochten sein.
Leider verfolgt die Essener Schau, für die das Museum dank Sponsor keine Mark bezahlen muß, das Werk nicht bis zur Gegenwart. Was macht Rivera heute? Er selbst sagt, daß er ähnliche Objekte anfertige wie damals. Und doch gebe es einen großen Unterschied: „Damals waren es Schreie. Heute ist es Gesang.“
Manuel Rivera: „Metamorphosen – Espejos“. Museum Folkwang Essen (Goethestraße). Bis 11. September. Di-So 10-18, Do 10-21 Uhr. Katalog 48 DM.