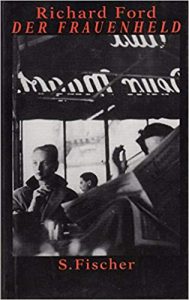Dunkle Rätsel aus dem Bergwerk der Bilder – Gemälde von Edgar Ende in Olpe
Von Bernd Berke
Olpe. Tragisches Schicksal eines Künstlers: Die Nazis verfemten Edgar Ende als „entartet“ und erteilten ihm Malverbot. Nach dem Krieg verlangte der Kunstbetrieb abstrakte Bilder, die Ende nicht liefern mochte. Doch seit ein paar Jahren wird er wiederentdeckt, denn er hat einen berühmten Sohn. Und der heißt Michael Ende.
In seiner „Unendlichen Geschichte“ hat Michael Ende dem Vater ein literarisches Denkmal gesetzt. Vom phantastischen „Bergwerk der Bilder“ ist da die ausführliche Rede. Tatsächlich hat Edgar Ende (1901-1965), von dem jetzt in Olpe eine Werkauswahl zu sehen ist, seine Motive gleichsam aus tiefer Finsternis heraufgeholt. Er zog sich tagelang in völlig abgedunkelte Stuben zurück, versehen mit Bleistift und Taschcnlampe, so daß er die Szenen, die aus seinem Inneren aufstiegen, sogleich skizzieren konnte. Später wurden Zeichnungen daraus, schließlich Ölbilder.
Die fast 40 Arbeiten in Olpe stammen allesamt aus Edgar Endes Nachkriegswerk. Man könnte sie leicht dem Surrealismus zuordnen, doch Ende hat nicht nur aus dem eigenen Unbewußten geschöpft, sondern vor allem aus mythologischen Quellen und der Bibel. Während der surrealistische Blick bei Salvador Dalí mit den Jahren zu oberflächenpolierter Glätte führte, ist bei Edgar Ende geradezu das Gegenteil der Fall. So achtlos trug er die düster-verwaschenen Farben auf, als gehe es ihm nur um die Inhalte und gar nicht um malerische Werte. So sind es denn meist eher seherische als künstlerische Offenbarungen.
Seltsame Kombinatorik: Edgar Ende stellt eine Madonnenfigur und biblisches Bcgleitpersonal neben Dutzende von roten Schuhen, die wiederum in einer Art Lederhaut stecken und wie Kugeln auf einem Rechenschieber angeordnet sind („Die roten Schuhe“), läßt aus einer giftig wirkenden Blüte einen Äskulapstab hervorwachsen („Die Mondblume“) oder malt ein leeres Geschäft, hinter dessen Theke ein abgeschlagener Kopf feilgeboten wird („Der verödete Laden“). Oft führt uns Edgar Ende zu den bedrohlichen Untiefen eines Ur-Wassers, auf dem rettende Flöße treiben, bevölkert er seine Szenarien mit geflügelten Wesen. Ein endlos weites Feld der Mystik tut sich auf, den Gedanken sind kaum Grenzen gesetzt.
Einige wenige Bilder scheinen sich etwas näher an der Zeitgeschichte zu orientieren. „Die die Heimat mit sich tragen“ (1947) könnte der Entwurf für ein Flüchtlings-Mahnmal sein, „De Profundis“ (1951) mag an versehrte Kriegsheimkehrer erinnern. Doch auch solche Bilder bleiben rätselvoll.
Michael Ende, der sich so nachdrücklich für seinen Vater stark macht (und ihn gar qualitativ mit René Magritte vergleicht), kann leider nicht zur Olper Ausstellungseröffnung (Sonntag, 11.00 Uhr) kommen, da er unter den Folgen eines Schlaganfalls leidet.
Edgar Ende – Kunstverein Südsauerland (Olpe, Altes Lyzeum, direkt neben dem Rathaus). 24. Juli bis 21. August. Werktags 16-18.45 Uhr, sonntags 15-18 Uhr, samstags geschlossen.