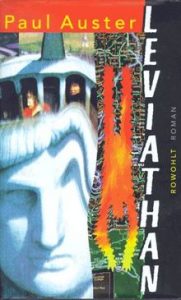Kunstverein Dortmund will in die erste Reihe – mit Serra-Ausstellung und weiteren Vorhaben
Von Bernd Berke
Dortmund. Mit einer Ausstellung des berühmten Richard Serra will der Dortmunder Kunstverein im Sommer ’95 Furore machen. Die Schau kommt aus New York, die Stationen heißen Lissabon, Dortmund und Rom. Weltstädte unter sich?
Bisher wurde das Projekt verschwiegen behandelt, nun ist es heraus: Zumindest großformatige Zeichnungen aus neuster Produktion des Amerikaners, dessen Stahlplastik „Terminal“ ein Wahrzeichen der Bochumer City ist, werden in Dortmund zu sehen sein. Und die Chancen auf ein größeres Ereignis stehen offenbar bestens.
Der Kunstverein verhandelt derzeit mit zwei bekannten Dortmunder Institutionen, die sich beteiligen könnten. Für eine Nennung ist es noch zu früh, aber man kann schon verraten: Ein Kooperations-Partner gehört zum öffentlichen Sektor, der andere zum privaten. Falls der Dreierbund zustande kommt, dürften zum Beispiel auch einige der tonnenschweren Stahlplastiken von Serra nach Dortmund kommen.
„Es wird höchste Zeit, daß der Dortmunder Kunstverein von sich reden macht“, findet Burkhard Leismann (41), der seit einigen Monaten als Ausstellungsmacher die Geschicke lenkt. Nach Beilegung gewisser Querelen (Ablösung seiner Vorgängerin) fühlt sich Leismann nun stark genug, um den Kunstverein als unverzichtbare Ergänzung zu den örtlichen Museen und Galerien zu etablieren.
Zu Köln und Düsseldorf aufschließen
Immerhin werde dieser Kunstverein schon zehn Jahre alt (am 27. November wird im Ostwall-Museum mit prominenten Gästen gefeiert), doch die Mitgliederzahl stagniere bei etwa 500 Leuten, von denen nur etwa 100 wirklich aktiv seien: „In einer Stadt mit über 600 000 Einwohnern und mit diesem Umland muß einfach mehr drin sein“, glaubt Leismann. In vier bis fünf Jahren, so sein Ziel, müsse der Mitgliederstand deutlich gewachsen sein. Denn mit jährlich etwa 50 000 DM an Jahresbeiträgen, die man jetzt einnimmt, lassen sich keine großen Sprünge machen.
Leismann, der parallel das Ahlener Kunstmuseum betreut, träumt „als alter Dortmunder“ davon, daß der hiesige Kunstverein mit den Pendants von Düsseldorf oder Köln in einem Atemzug genannt wird. Er möchte die Kräfte und Kontakte des Kunstvereins auch für Dienstleistungen einsetzen, sprich: Man könne ganze Kulturprogramme für Unternehmen maßschneidern – gegen Bezahlung, versteht sich. Auf diese Weise ließen sich auch die schmalen Mitgliedsbeiträge aufstocken. Und wer nebenbei noch spenden will, wird ganz gewiß auch nicht abgewiesen.
Nicht nur solche Aktivitäten und die Serra-Ausstellung sollen für Belebung sorgen. Neben einer Reihe mit südamerikanischer Kunst ist auch eine originelle Aktion mit lokalem Bezug angelaufen. Der Kunstverein hat 1000 Dortmunder um die Beschreibung ihrer liebsten Wegstrecken in der Stadt gebeten, die ersten Antworten treffen gerade ein. Einige Dutzend Wege im gesamten Stadtgebiet sollen dann von einem Kölner Künstler mit Acrylfarbe markiert werden. Keine bittere Kritik an Bausünden und mißlicher Stadtplanung also, sondern ganz im Gegenteil: nachdrückliche Hinweise auf womöglich verborgene Schönheiten. So etwas entspricht Leismanns Neigung zum positiven Denken.