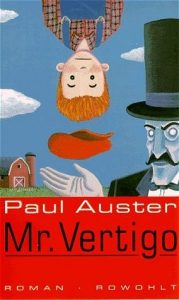Wenn das Lächeln gefriert – 31 chinesische Gegenwartskünstler in Bonn
Von Bernd Berke
Bonn. Künstler aus dem „Land des Lächelns“ zeigen die Zähne. Und das darf man wörtlich nehmen. Bemerkenswert, daß einige der 31 chinesischen Gegenwartskünstler, deren Bilder jetzt in Bonn gezeigt werden, das gleiche Thema aufgreifen: die traditionelle Erziehung zur dauerhaft guten Miene, mit der man klaglos und ohne Gesichtsverlust private (oder auch politische) Schande hinnehmen soll.
Doch auf diesen Gemälden ist das Lächeln gefroren, verzerrt zum Haifisch-Grinsen oder bizarr gesteigert zum zynischen Gelächter über die Zustände. Und noch ein Thema kehrt in auffallend vielen Bildern wieder: schwebende Menschen. Sind s erträumte Flüge in eine Ungewisse Zukunft? Und falls ja: Wunsch- oder Alpträume?
Kreuz und quer durch die Provinzen
Neun Wochen waren der Chef des Bonner Kunstmuseums, Prof. Dieter Ronte, der TV-Kulturfilmer Walter Smerling und ihre chinesischen Begleiter im „Reich der Mitte“ unterwegs, kreuz und quer durch die Provinzen. Bei ihrer Kunst-Auswahl haben die Herren nicht mit offiziellen Stellen Chinas zusammengearbeitet, aber auch nicht gegen sie. Sie haben sich vor allem auf die Sachkenntnis von chinesischen Akademie-Professoren und Kunstkritikern gestützt. So kam man zu einer gediegenen, punktuell auch aufregenden Schau.
Die beteiligten Akademiker führen eine Doppelexistenz: Sie unterrichten – nach streng festgesetzten Regeln – herkömmliche Techniken wie Kalligraphie (Schönschrift), daneben aber produzieren oder fördern sie Kunst, die von Dissidenten stammen könnte.
Trotzdem bereitete die vorübergehende Ausfuhr nach Deutschland keine Probleme. Alles, was nicht älter als 150 Jahre ist, darf anstandslos die chinesischen Grenzen passieren. Die mit 150 Öl-Bildern heimgekehrten Museumsleute sprechen gar von einer „erstaunlichen Freizügigkeit“ in China. Haben sich denn alle geirrt, die die Menschenrechte in China verletzt sehen?
Bestimmt nicht. Zwar erlaubt das chinesische Regime listig die private Kunstschöpfung jedweder Richtung, doch werden kritische Bilder eben nie öffentlich gezeigt. Es gilt weiter die Doktrin des wirklichkeitsfernen Sozialistischen „Realismus“ asiatischer Spielart.
In bisher beispielloser Breite vereint die Schau aktuelle Künstler aus verschiedenen Regionen Chinas. Man hat Wert darauf gelegt, keine Exilkünstler einzuladen, sondern nur solche, die in der Volksrepublik leben. Daß es ausschließlich Männer sind, liegt wohl just daran, daß Frauen im chinesischen Kulturleben noch kaum eine Rolle spielen.
Mao ist nur noch ein Papiertiger
Diese Künstler also geben entschieden individuelle Antworten auf die Zeitläufte. Und doch scheinen sich einige Themen generell aufzudrängen, vor allem das Einsickern westlicher Produkte und Lebensstile ins wirtschaftlich sich öffnende Land. Sonnenklar wird dies bei Zhang Gong aus Peking, dessen ratloser Rotarmist umstellt ist von lauter kapitalistischen Marken-Emblemen sowie einer Armee aus Andy Warhols Marilyn-Monroe Reproduktionen.
In dieser gewandelten Welt ist der einstmals „große Vorsitzende“ Mao Tse-Tung, umrißhaft zu erahnen auf Bildern des Xue Song, nur noch eine anonyme Silhouette, ein bloßer „Papiertiger“. Und etliche Darstellungen, die auf die Chinesische Mauer anspielen, lassen an einen Gefängniswall denken.
Manche Künstler nehmen, als Nachfahren der amerikanischen Pop Art (deren Einfluß in China derzeit abklingt), auch schon die Schattenseiten der Konsum-Freiheiten wahr. Nicht nur Zeng Fanzhi führt (in einer „Masken-Serie“) Fratzen großstädtischer Entfremdung vor. Song Yonghong brandmarkt die Langeweile im Luxus, und Wei Guangoing enthüllt die sexuellen Oberflächenreize der Reklame im Kontrast zu alten erotischen Holzschnitten. Bilder einer neuen Unübersichtlichkeit.
„China!“ – Zeitgenössische Malerei. Kunstmuseum Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 2 („Museumsmeile“). Di-So 10-18 Uhr, Katalog 39,50 DM.