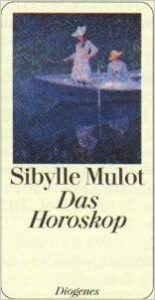Kunst soll wirken wie ein Nackenschlag – Werkschau über Bruce Nauman in Wolfsburg
Von Bernd Berke
Wolfsburg. Mal ehrlich: Was hat Wolfsburg schon zu bieten? Das gigantische VW-Werk, gewiß. Aber in dessen Schatten ducken sich ein barackenartiger Bahnhof und eine beklagenswert öde Innenstadt. Ausgerechnet hier soll ein Juwel der deutschen Kulturlandschaft zu finden sein? Aber ja!
Das imposante Kunstmuseum Wolfsburg, im Grundriß etwas größer als ein Fußballfeld, verfügt über finanzielle Mittel, von denen man andernorts höchstens träumt. Jetzt bietet man mit einer Schau über den US-Künstler Bruce Nauman erneut ein Ereignis der Sonderklasse.
Während etliche Häuser in den Metropolen mit jährlichen Ankaufsetats von nicht einmal 100 000 Mark (ein Witz angesichts der Kunstmarkt-Preise) wirtschaften, schöpft man in Wolfsburg aus dem Vollen. Das erst vor drei Jahren eröffnete Museum hat bereits umfangreiche Eigenbestände angehäuft. Ständig kauft man namhafte Werke hinzu: Hier ein Bild von Andy Warhol oder Anselm Kiefer, da einen Kunst-Iglu von Mario Merz oder eine Video-Installation von Nam June Paik.
Mit öffentlichen Mitteln ist das nicht zu schaffen, sondern nur mit einer reich ausgestatteten Privatstiftung, die vor allem aus Vermögensanteilen am Volkswagen-Versicherungsdienst (VVD) gespeist wird. Hier dürfte der alte VW-Werbeslogan zutreffen}: „Da weiß man, was man hat.“
Weiter nach Paris und London
Die Nauman-Schau, die in Wolfsburg Premiere hat, teilt man sich mit ersten Adressen. Sie wandert ins Pariser Centre Pompidou und in die Londoner Hayward Gallery. Kunsthallenchef Gijs van Tuyl und sein Team haben eine Ausstellung von seltener Suggestionskraft inszeniert. Der Rundgang ist schneckenförmig angelegt, auf daß man erst hinausfinde, nachdem man ins Zentrum vorgedrungen ist.
Das ist ganz im Sinne Naumans. Er gibt dem Betrachter gern die Wege vor. So schickt er ihn etwa in einen nur 50 Zentimeter schmalen, viele Meter langen Raumschlauch, an dessen Ende man seinem eigenen elektronischen Abbild begegnet. Ein andermal kann man sich – dank eines ausgeklügelten Kamera-Aufbaus – beim Gang um ein Karree selbst hinter den Ecken verschwinden und gleichzeitig die Leute hinter einem auftauchen sehen. Seltsame Zeit-Verschiebung.
Schon in den 70er Jahren hat Nauman (Jahrgang 1941) mit der damals noch ganz neuen Video-Technik experimentiert, seither hat er alle Feinheiten ausgelotet. Ein Kunstwerk solle sein wie „ein Schlag in den Nacken“, es solle umweglos aufs körperliche Befinden einwirken. So lautet ein immer wieder eingelöstes Bekenntnis Naumans, des Stamm-Teilnehmers der documenta, der sich seit zehn Jahren vom Kunstbetrieb zurückgezogen hat, keine Interviews mehr gibt und lieber in New Mexico Pferde züchtet.
Inspiriert von Cage und Beckett
Drei abgedunkelte Räume mit TV-Bildschirmen, auf denen menschliche Köpfe rotieren. Sie stammeln unaufhörlich Lautfolgen wie „Okay-okay-okay“ oder auch nur „Mh-mh-mh“. Man fühlt sich in dieses kreiselnde Wahn-System eingesperrt und faßt sich unwillkürlich an den Hals: Dreht der sich auch schon? Kurz darauf gerät man vor das Videowerk „A poke in the eye“ (etwa: Ein Stoß ins Auge). Ganz langsam tastet die Kamera ein Gesicht porengenau ab und irrt immer wieder zu den Augen hin. Zumal wenn man den Titel vorher kennt, erfaßt einen ein Gefühl der Bedrohung als Kitzel in der Magengrube. Solche Regungen hat der Künstler wohl nicht nur an sich selbst erprobt, sondern auch kühl vorausberechnet.
Der einstige MathematikStudent ließ sich von Wiederholungs- und Montage-Strukturen etwa in Werken des Komponisten John Cage, des Schriftstellers Samuel Beckett oder des Filmregisseurs Jean-Luc Godard anregen.
Viele Installationen sind höchst komplex, sie beziehen z. B. Neonlicht, Texte oder Klänge ein. Man muß es erleben. Und man wird in eine Art Trance zwischen Irritation und Meditation geraten.
Kunstmuseum Wolfsburg, Porschestraße 53 (Tel: 05361 / 266 966). Ausstellung Bruce Nauman bis 28. September. Di 11-20 Uhr, Mi-So 11-18 Uhr. Eintritt 7 DM. Katalog 45 DM.