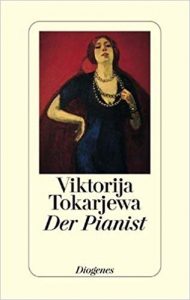Dieses Leben, das die Menschen zermalmt – „Der Pianist“: Drei Erzählungen von Viktorija Tokarjewa
Von Bernd Berke
Will man erfahren, was entschlackter Stil ist, so sollte man die Erzählungen der Russin Viktorija Tokarjewa lesen. Mit ein paar prägnanten Skizzen-Strichen ist die Erzählsituation aufgebaut – und schon befindet man sich mittendrin.
Drei Erzählungen enthält ihr Band „Der Pianist“. In der Titel-Geschichte geht es um jenen Klaviervirtuosen Mesjazew, dessen Familienleben desolat verläuft. Nach einer Deutschlandtournee gerät er vollends in die Sinnkrise und kommt in ein Sanatorium. Dort lernt er die Vamp-Frau Ljulja kennen und (mitten im Schnee) körperlich lieben, wobei Eierlikör über ihren Pelzmantel rinnt – Bild einer Sinnlichkeit, die haltlos alles besudelt.
Eine verzehrende Sucht nach dem ganz anderen Leben bricht sich düster Bahn. Drang nach Freiheit und zugleich die Angst vor davor vereinen sich zu einem fatalen Gemisch. Die Episode führt nach und nach zur völligen Zerstörung des familiären Restzusammenhalts. Was bleibt, ist Melancholie. Dieser Zerfall spiegelt die mehr als mißliche gesellschaftliche Lage in Rußland, wobei die wenigen Polit-Einsprengsel zuweilen fatal klingen, so als seien Dissidenten in erster Linie Defätisten und als bedeute Demokratie vor allem Schrankenlosigkeit.
, Kosmische Liebe“ zeigt wiederum zwei tief vereinzelte Menschen, die sich für kurze Zeit ineinander festkrallen: Jelissejew, Fotograf einer Filmcrew, und seine Kollegin Lena, deren Mann gerade gestorben ist. Beide Lebensläufe werden im Fortgang ihrer kurzen und heftigen Beziehung wie im Brennspiegel eingefangen. Wir hören von allseits nutzlos verkümmernden Talenten, von Alkoholismus, Bindungsunfähigkeit und einem Selbstmordversuch. Alle leiden unter einem Leben, das die Menschen nach und nach zermalmt. Erneut stehen Einzelschicksale fürs große Ganze. Schale Lockungen des Westens werden in Kontrast gesetzt zur althergebrachten russischen Seelentiefe.
„Löffelweise Kaviar“ gibt es in der gleichnamigen Abschluß-Erzählung. Nick, nicht mehr ganz junges Schauspieltalent aus England, ist soeben von seiner Frau verlassen worden. Ein 83jähriger Milliardär bietet ihm nun die vermeintliche Chance seines Lebens: Nick soll mit ihm in dessen russische Heimat reisen und sich dort – gegen Bezahlung – stellvertretend für den siechen Greis kulinarisch und erotisch amüsieren.
Geldsegen und noch dazu Genuß sofort? Nein, es ist ein perfider Teufelspakt. Denn Nick muß wirklich alle Wünsche des Alten erfüllen, beispielsweise Kaviar buchstäblich fressen bis zum Erbrechen. Auch seine neue Liebe wird zerstört, als die Frau von der beschämenden Vereinbarung erfährt. Da fühlt sie sich als sexuelles Versuchsobjekt. Ein literarisch überzeugender, manchmal gar überwältigender Band. Wenn nur diese ideologischen Spurenelemente nicht wären…
Viktorija Tokarjewa: „Der Pianist“. Erzählungen. Diogenes. 167 Seiten. 34 DM.