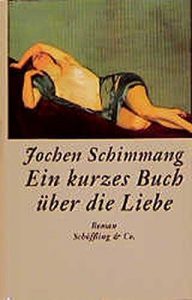Kunst aus dem Geiste der Unordnung – „Gefährdetes Gleichgewicht“ in der Bochumer „Galerie m“
Von Bernd Berke
Bochum. Häuser und Straßen zerfließen, vom Himmel regnen Bäume herab. Natur und Zivilisation werden in einen Strudel hineingerissen. 1919 malte Chaim Soutine diese in völliger Auflösung begriffene „Landschaft bei Gagnes“. Das Bild ist wie ein erster Grundakkord zur Ausstellung in der renommierten Bochumer „Galerie m“: „Gefährdetes Gleichgewicht“.
Galerist Alexander von Berswordt-Wallrabe (54) spürt in hochkarätigen Werken aus eigenen Beständen und einigen Leihgaben einem allgemeinen Muster in der Kunst dieses Jahrhunderts nach: Der Ausstellungstitel meint verlorene Balance und Verunsicherung auf allen Ebenen, in vielfältigen Formen und vor allem: Verformungen.
Erlesen schon der Auftakt: Chaim Soutine und Lovis Corinth leiten gegenständlich zum Thema hin. Auch Edvard Munch („Zwei Menschen“) gehört noch in diese Abteilung. Er malte eine Szene abgrundtiefer Fremdheit zwischen Mann und Frau, und der Franzose Auguste Chabaud zeigt in depressivem Rostrot einen gähnend leeren Hotelflur, auf dessen Treppe man gerade noch einen menschlichen Fuß verschwinden sieht. Im Wortsinne bestürzende Einsamkeit. Offenbar bleibt nur die hastige Flucht. Aber wohin?
Als werde es nie wieder Gewißheit geben
Ist man derart eingestimmt und auf unsicheres Gelände geführt worden, fällt auch das Verständnis der abstrakten Arbeiten leichter. Den Übergang markiert die „Große Meditation“ (1936) von Alexej Jawlensky, eine düstere Struktur, erst bei näherem Hinsehen als Ur-Form eines leidenden Gesichts erkennbar. Sodann Josef Albers: Er läßt 1940 mehrfach den Buchstaben „X“ übers Bildgeviert paradieren („Marching X“); ganz behutsam, aber dann doch nachhaltig verstörend ist hier jedwede Linie aus dem Lot gerückt. Gefährdetes Gleichgewicht eben.
In seiner „Struttura pulsante“ (pulsierende Struktur) variiert Gianni Colombo das Thema anno 1960 mit maschineller Hilfe: Ein Motor treibt Dutzende von Styropor-Quadern an, die sich durch eine Art Zufallsgenerator verschieben und knarzend aneinander reiben. Bevor das Kunstwerk erstmals in Betrieb gesetzt wurde, herrschte Gleichmaß. Seitdem aber bringt die Arbeit aus sich selbst immer neue Chaos-Varianten hervor – sozusagen eine fortwährende Geburt der „Unordnung“. Und nun ist es, als könne nie wieder Ruhe einkehren, als werde es nie wieder Gewißheit geben.
Auch die Zahlen halten keinen Trost bereit
Das irritierende Flimmern von Op-art-Kompositionen (Victor Vasarely, Bridget Riley) spielt die Grundidee brüchig gewordener Sicherheiten ebenso durch wie François Morellets witziges Schieflage-Experiment mit Rahmen und Hängung eines Bildes oder eine arithmetisch ausgeklügelte Bodenplastik von David Rabinovitch, die ihre Bedrohlichkeit aus dem Fundus der Mathematik erzeugt. Auch die scheinbar objektiven Zahlen bergen mithin keinen sicheren Trost mehr. Im Gegenteil.
Unübertreffliche Formfindungen jenseits jeder Beliebigkeit sind schließlich jene Skulpturen des Amerikaners Richard Serra, der in Deutschland just durch die „Galerie m“ bekannt wurde. Das „Kartenhaus“ aus mehreren Bleiplatten, ganz fragil ausbalanciert: Mahnmal einer gerade noch abgewendeten, aber stets gegenwärtigen Gefährdung. Eine tonnenschwere Stahlplatte im Innenhof, an einer Seite leicht abgesenkt, bekam den Titel „Tod“. Aus dem mächtigen Quader quillt leise, aber unabweisbar eine tiefe Trauer über Vergänglichkeit.
„Gefährdetes Gleichgewicht“. – „Galerie m“, Bochum, Nevelstraße (Haus Weitmar). Tel. 0234 / 4 39 97. Bis 10. September Mi, Fr, Sa. 17-19 Uhr und nach Vereinbarung. Katalog (Richter-Verlag, Düsseldorf) 28 DM.