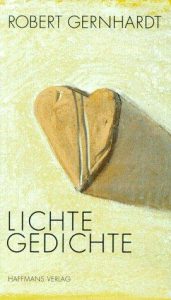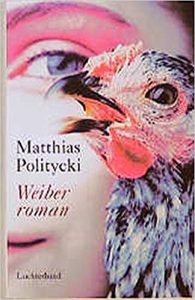Auch das Theater braucht einen Libero – Gespräch mit dem WLT-Intendanten Harald F. Petermichl
Von Bernd Berke
Castrop-Rauxel. Das Westfälische Landestheater (WLT) behält seinen Sitz auf absehbare Zeit in Castrop-Rauxel. Von einem Umzug nach Iserlohn ist derzeit nicht mehr die Rede. Das – und einiges mehr – erfuhr die WR im Gespräch mit dem WLT-lntendanten Harald F. Petermichl (40).
Der gebürtige Bayer und bekennende Fußballfan arbeitet seit 1991 am WLT. Er ist nach dem Weggang seines Ko-Direktors Norbert Kronisch (der Intendant in Osnabrück wurde) alleiniger Leiter der Bühne. Petermichl steckt mitten in den Vorbereitungen zur Saison, die am 6. September mit „Der eingebildete Kranke“ beginnt.
Was ändert sich beim WLT, nachdem Sie Solo-Intendant geworden sind?
Harald F. Petermichl: Ich würde meine ganze bisherige, Arbeit in Frage stellen, wenn ich sagen würde: „Ab jetzt machen wir alles ganz anders.“ Wir haben offenbar eine recht gute Mischung gefunden – zunehmend auch für jüngere Zuschauer. Wir sind beim WLT ein eingespieltes Team – wie eine Fußballmannschaft.
Und Sie sind der Mittelstürmer?
Petermichl: Eigentlich sollte ich Libero sein. Immer da stehen, wo’s brennt.
Apropos brennen. Wie steht s mit den Finanzen?
Petermichl: Die Zuschüsse sind seit 1994 nicht mehr erhöht worden. Vom Land gibt es 4.2 Millionen Maik, vom Landschaftsverband um die 800.000, von der Stadt Castrop-Rauxel 325.000 und von den 16 Mitgliedsstädten unseres Trägervereins insgesamt rund 90.000 Mark. Die bekommen dann auch Rabatt, wenn sie unsere Stücke buchen.
Wie wirkt sich das Einfrieren der Subventionen aus?
Petermichl: Die Preise steigen, und wir müssen rundum sparen. Aber jetzt sind wirklich alle Reserven aufgebraucht. Schon ein Prozent Tariferhöhung bedeutet: Wir haben 50.000 Mark im Jahr weniger. Um so betrüblicher, daß manche Kommunen gleichfalls sparen und ihre Gastspiel-Buchungen reduzieren. Manche buchen nur noch unsere Revue. Da bekommen die Zuschauer ein ganz falsches Bild von unserer Arbeit. Als ob wir ein Revuetheater wären!
Eine Versuchung, nur noch gängige Stücke anzubieten?
Petermichl: Es ist halt eine Mischkalkulation. Zwei bis drei Stucke müssen sich gut verkaufen, dann kann man sich auch ein paar riskantere leisten, zum Beispiel diesmal George Taboris „Weisman und Rotgesicht“. Wenn man nur noch auf die Kasse schielt, geht auch der Spaß flöten.
Sie gastieren häufig in Südwestfalen. Was ist denn eigentlich aus dem Plan worden, daß Ihre Bühne dort einen neuen Standort bekommt und ins Parktheater Iserlohn umzieht?
Petermichl: Im Moment liegt das auf Eis. Es wird seit fast zwei Jahren zwar irrsinnig viel drüber gesprochen, doch es gab immer nur unverbindliche Absichtserklärungen. Es liegt bis heute kein konkretes Angebot aus Iserlohn vor, dem man entnehmen kann: Wenn wir da hingehen würden, dann hätten wir die und die Vorteile. Außerdem herrscht bei uns keine große Begeisterung über einen eventuellen Umzug. Die Schauspieler sind es ja gewohnt, alle zwei bis drei Jahre woanders hinzuziehen. Doch die Leute aus Technik und Verwaltung fühlen sich an Castrop-Rauxel gebunden; Es ist ja auch ein guter Standort für uns, das Verhältnis zur Stadtverwaltung ist bestens. Wir bespielen Orte im ganzen Land, und da liegen wir hier ziemlich zentral.
Was steht auf dem neuen Spielplan?
Petermichl: Zwei markante Beispiele: Als klassisches Stück haben wir Schillers ..Kabale und Liebe“ im Programm, als musikalische Produktion die „Urlaubsrevue“, eine unterhaltsame Geschichte des Reisens von der Kutsche bis zum Flugzeug, garniert mit vielen populären Liedern.
Sie selbst proben zur Zeit Michael Endes „Jim Knopf“. Ist Kindertheater bei Ihnen Chefsache?
Petermichl: Nun, das hat auch mit meiner Biographie zu tun. Ich komme vom Kinder- und Jugendtheater her, und ich halte es einfach für eine wichtige Sparte. Es ist die einzige Theaterform, mit der man noch alle sozialen Schichten erreicht. Wenn der Intendant das Kinderstück macht, ist das auch ein Zeichen.