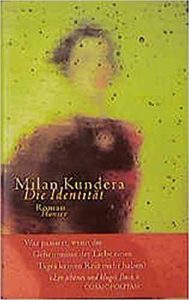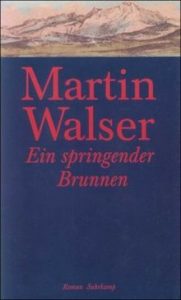Alle Dinge neu erfinden – Hagener Osthaus-Museum präsentiert Allan Wexler und Milly Steger
Von Bernd Berke
Hagen. Im KarI-Ernst-Osthaus-Museum ist jetzt ziemlich viel im Eimer. Nicht im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinne. Denn dem US-Künstler Allan Wexler hat es nun einmal dieser vermeintlich simple Alltagsgegenstand angetan. Er spielt nahezu alle Gedankenbilder durch, die vom Wasserbehälter angeregt werden können.
Es ist, als wollte Wexler (geboren 1949) die Dinge der Welt von Grund auf noch einmal neu überdenken und behutsam umbauen. Da fängt man am besten mit den einfachsten Objekten an. Wexlers schier unerschöpfliche, mit Sanftmut umgesetzte Vorstellungskraft läßt also den Eimer viele, viele Zustände durchlaufen, gleichsam auf Probe. Ganz so, als folge er mit ironischem Sinn dem berühmten Brecht-Satz „Er hat Vorschläge gemacht…“
Es gibt hier Eimer mit und ohne Ausgußtülle, es gibt welche aus Holz, aus Gips, manchmal von herkömmlicher Statur, dann wieder umgeformt: zum Trichter, zur Tröte, zur Wanne. Überhaupt sind es die meisten dieser Eimer leid, gewöhnliche Exemplare zu sein. Diesen kann man zu viert tragen wie eine Sänfte, jener mutiert zum überdimensionalen Meßbecher, ein dritter verbirgt sich im Rucksack, ein vierter unter dem Hut. Und so weiter.
Wexler, von Haus aus Architekt, durchstreift die verwaisten Felder zwischen angewandter und freier Kunst. Seine Modelle könnte man nachbauen, beispielsweise jenes theoretisch riesenhafte Aquädukt, das die gesammelten Wassermassen in einen einzigen – nun ja – Eimer leiten soll.
Liebenswert umständlich
Überhaupt wirken viele Gedanken und Formfindungen Wexlers liebenswert umständlich bis abwegig. Der schnurgerade Weg wäre eben nicht der Königsweg der Phantasie. Und die Schrullen von heute sind oft die Ideen von morgen. Auch Schirme und allerlei Flaschen kommen bei Wexler zum Einsatz, um das offenbar kostbare Nass aufzufangen, zu sammeln und zu bewahren. Sein „Gemeinschaftsbrunnen“ sieht ganz so aus, als sollte er nicht nur ein Grundbedürfnis befriedigen, sondern auch ungeahnte Gemeinschaft zwischen den Menschen stiften; wie denn überhaupt derlei herzliches Bemühen um Wassergewinnung auch politisch-soziale Hintergedanken wecken kann.
In der ersten Etage wechselt Wexler die Gegenstände, im Prinzip aber nicht die überaus experimentierfreudige Produktionsweise. Nun widmet er sich mit nicht nachlassender Detailfreude den Stühlen und Tischen. Auch ihre formalen (Un)-Möglichkeiten werden durchgespielt. Wie ißt man auf einem ganz und gar schrägen Tisch? Man legt passende Keile unter die Teller, dann stehen wenigstens die gerade. So tummelt sich Wexler in den Winkeln der Welt und erfindet sie neu.
Die Frau mit der Kraft eines Büffels
Einen denkbar starken Kontrast zu solchen Versuchen setzt die zweite neue Osthaus-Ausstellung. Sie umfaßt rund 50 plastische Arbeiten von Milly Steger (1881-1948), die lange Zeit in Hagen gelebt und dieser Stadt anno 1911 auch einen handfesten Kunststreit beschert hat, als sie vier überdimensionale nackte Frauenfiguren aufs Theater setzte.
„Die Grenzen des Frauseins aufheben“ heißt, ein wenig pathetisch, diese Schau. Gemeint ist, daß man weiblichen Wesen zu Beginn Beginn des Jahrhunderts weder das räumliche Denken noch die physische Kraft zutraute, um Skulpturen zu schaffen. Milly Steger aber setzte sich in der Männerdomäne derart durch, daß Else Lasker-Schüler sie lyrisch als „Büffelin an Wurfkraft“ pries. Die Skulpturen-Auswahl vermittelt ein uneinheitliches Bild. Mal kommt Milly Steger Zeitgenossen wie Barlach oder Lehmbruck an Ausdruckskraft nah, dann wieder verschwimmen die Züge ihrer Figuren ins gar zu Gefällige.
Karl-Ernst-Osthaus-Museum, Hagen (Hochstraße 73 / 02331 / 207 31 38). Ausstellungen Allan Wexler (Katalog 32 DM) und Milly Steger (Katalog 30 DM), jeweils ab heute bis zum 1. November. Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr.