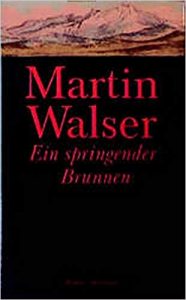Das Leben ist wie ein bleicher Traum – Hamm zeigt Heinrich Vogelers Frühwerk im Umkreis des Jugendstils
Von Bernd Berke
Hamm. „Schöner wohnen – edler leben“. Dieser Slogan könnte für die neue Ausstellung im Gustav-Lübcke-Museum werben. Der umfassende Überblick zum Frühwerk des Heinrich Vogeler (1872-1942), konfrontiert mit Schöpfungen anderer Künstler aus dem Jugendstil-Umkreis, wirkt wie die Feier eines stilvollen, aber auch bis zur Erstarrung stilisierten Lebens.
Vogeler, begütert aufgewachsener Bremer Kaufmannssohn, bewies – als Maler, als Architekt, mit Alltags-Entwürfen – einen Hang zum Komfort. Der hochbegabte Autodidakt betätigte sich als umtriebiger Universalkünstler. Vom Mobiliar bis zum Besteck, von der Buchillustration bis zum Schmuckstück erstreckte sich sein weites Feld.
Der Zeitgeist zur letzten Jahrhundertwende wollte es so: Man verabschiedete sich vom Historismus und griff (statt auf die Geschichte) lieber auf natürliche Formen zurück. Zumal aus dem reichen Repertoire der Pflanzenwelt erwuchsen die typischen Ornamente des Jugendstils. Einem solchen Bildvokabular konnten sich weder Vogeler noch Peter Behrens oder Henry van de Velde ganz entziehen. Die beiden Letzteren fanden freilich, wie die Ausstellung zeigt, alsbald zu funktionaleren Formen.
Auf drei Etagen verteilen sich die rund 300 Exponate in Hamm: Im Erdgeschoß findet man Malerei, im ersten Geschoß „Design“ und ganz oben Belegstücke zum architektonischen Schaffen.
Traumzeit regiert in der malerischen Abteilung: Hier sieht man sich satt an blumig umrankten, oft ätherisch oder gar etwas mondsüchtig dreinschauenden, zarten jungen Frauen. Diese bleichen, beinahe transparenten Wesen blicken in die Welt, als könnte ihre unnennbare Sehnsucht sie im nächsten Moment himmelwärts davontragen.
Märchenhaftes Mischwesen aus Fee und Fisch
Prägnantes Beispiel ist „Melusine“ (um 1910), dreiteiliges, an einen Altar gemahnendes Prunkbild: Ein Mädchen – halb Fisch, halb Fee – thront traumverloren inmitten einer märchenhaften Naturkulisse. Kitschverdächtig monumental, füllt das symmetrisch aufgebaute Gemälde „Sommerabend“ (1905) eine Wand. Hier gefriert weltenthobenes Dasein zwischen Flora und musikalischer Ergötzung zur vollends idyllischen Szenerie.
Mit seinen zwei Ehen hatte Vogeler wenig Glück. Frauen aus Fleisch und Blut konnten schwerlich dem hehren Ideal genügen, das in solchen Bildern aufscheint. Gelegentlich streifte Vogeler weiblichen Modellen gleich ein „Reformkleid“ über, auf daß sie seine Weltsicht rein verkörperten. Eine Männerphantasie, wenn auch eine sanftmütige.
Die schönsten Blüten trieb seine Kunst der Buchillustration. Der mit dem Dichter Rilke befreundete Vogeler schuf vor allem für die Insel-Bücherei wundervolle Zierden und Girlanden rund um die Literatur. Über erstaunlich zweckmäßige, weit weniger verspielte Möbel und Alltagsgegenstände arbeitet sich der Besucher zum architektonischen Rüstzeug Vogelers vor. Regionaler Bezug: Für den Hammer HNO-Arzt Emil Löhnberg, einen Anhänger der Gartenstadt-Bewegung, entwarf Vogeler ein schmuckes Fachwerk-Sommerhaus im sauerländischen Willingen, dessen Grundzüge heute noch als Flügel eines Hotels erhalten sind.
Angesichts der Hammer Schau ist es kaum zu glauben, daß Vogeler in den 30er Jahren nach Moskau zog, wo er zu einem Vorläufer des unsäglichen „Sozialistischen Realismus“ wurde. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Gustav-Lübcke-Museum, Hamm (Bahnhofstraße 9). 25. Oktober bis zum 10. Januar 1999, tägl. 10-18, mittwochs 10-20 Uhr. Eintritt 10 DM. Katalog 49 DM.