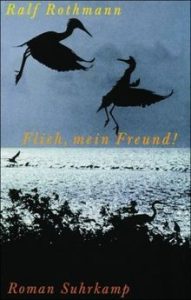Zerrüttung und Wahn – einst und jetzt / Uwe Dag Berlin inszeniert Hauptmanns „Einsame Menschen“ in Bochum
Von Bernd Berke
Bochum. Was tun diese drei Frauen denn bloß? Sie schlagen um sich, als wollten sie ungute Träume wie lästige Insekten verscheuchen, dann reden sie wirr verhuscht aneinander vorbei, beziehungslos vor sich hin. Das soll also der Beginn von Gerhart Hauptmanns Stück „Einsame Menschen“ (1890) sein? In Bochum, wo jetzt Uwe Dag Berlin das Drama inszenierte, glaubt man’s anfangs kaum.
Geräumiges Landhaus am Müggelsee bei Berlin. Hierhin hat sich der Philosoph Johannes Vockerat (Martin Olbertz) samt Gattin Käthe (Annika Kuhl) und Baby zurückgezogen, um sein denkerisches Werk zu verrichten. „Sich einmummeln“ nennt die biedere Käthe das – in eher schaurigem als wohligem Vorgefühl. Und es wird ja auch nichts draus. Kaum taucht die Studentin Anna (Annemarie Knaak-Tiefenbacher) als Gast des Hauses auf, ist die Ruhe hin, und das Herz wird schwer. Johannes verliebt sich, sozusagen erst in ihren freien Geist, dann überhaupt in die Frau. Der Rest ist schlimmste Familien-Zerrüttung, Selbstmord, Wahnsinn.
Am Anfang toben und tollen sie durch den Text
In Bochum taumeln diese Menschen oft in größtmöglicher Distanz dahin. Manchmal brauchen sie gar Ferngläser, um die anderen noch wahrzunehmen. Furchtbar vereinzelte Leute eben. Wenn gegen Schluß des langen Abends ein Titel der Gruppe „Ton Steine Scherben“ („Alles, was uns fehlt / Ist die Solidarität“) aus den Lautsprechern dröhnt, so klingt das wie bittere Wahrheit, trostloser Hohn und hohle Phrase zugleich.
Ein gar finsteres und sprachlich schroffes Stück, das freilich in Bochum zunächst hell bis grell aufleuchtet. Vor roten Tapeten, zwischen umgestürzten Stühlen und unterm bezeichnenden Bildnis zweier Wissenschafts-Patriarchen (Bühnenbild: Hamster Damm) werden weite Teile der ersten Hälfte verjuxt, man tobt und tollt durch den Text.
Mit manisch wiederholten Gesten, von denen sie ganz beherrscht werden, stürmen die Figuren nach und nach die Bühne. Sie brüllen sich was von den Seelen. Groteske Witzfiguren. Hauptmann, so fürchtet man, wird zum Gaglieferanten fürs frei improvisierende Slapstick-Theater degradiert. Sehen und staunen im Kicher-Kabinett, vor allem die Manner sind ziemlich gaga: Der alkoholgierige Pastor (Heiner Stadelmann) würgt am Hals einer Weinflasche, die er zu tief in den Mund eingeführt hat.
Fein gesponnenes Verhältnis des Stoffs zu unserer Gegenwart
Johannes‘ Vater schnarrt immer mechanisch „Tja-Tja“ und ist so wenig bei Sinnen wie sein grüblerischer Sohn, der sich auch schon mal jaulend in den Teppich einwickelt.
Mag sein, daß es bei all dem mächtigen Proben Spaß gegeben hat, dessen Reste zur Premiere nur noch nicht ganz abgeschüttelt sind. Denn es entwickelt sich ja ganz anders. Die dreieinhalbstündige Inszenierung ergeht sich zunehmend in leiseren Momenten; sie spürt nun, da der Trubel gemindert ist, wirklich aufmerksam dem Schmerz der Personen nach und gewinnt frappierend an Nuancenreichtum. Und zwar auf zeitgemäße Weise: Aufgefächert werden nicht nur die Leiden der Eifersucht, sondern auch gesellschaftliche Zwänge („Frauenfrage“, wie man seinerzeit sagte).
Man merkt durchaus, daß der Text mittlerweile historisch ist, aber die Inszenierung legt – aufs Ganze gesehen – recht behutsam Schichten neueren Erlebens darüber. Ohne Jahrzehnte des Selbsterfahrungs-Kults, politischer Revolten oder auch die Tics der Computer-Generation wäre sie so nicht denkbar. Respekt vor dem Ensemble, das mehrere zeitliche Ebenen und Gefühlslagen sinnfällig überblenden kann!
Und so wird Hauptmanns letztlich doch nicht verkaspert, sondern in ein fein gesponnenes Verhältnis zu unserer Gegenwart gesetzt. Manche sagen, daß Theater genau dazu da seien. Der frenetische Beifall prasselte lang.
Termine: 5., 18., 23. und 26. Dezember. Karten: 0234/3333-111.