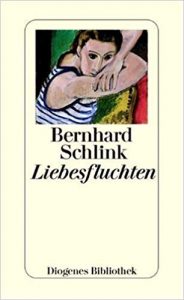Gottsucher auf den finsteren Klippen – Späte Uraufführung des 1938 geschriebenen Stücks „Nacht“ von Gertrud Kolmar
Von Bernd Berke
Düsseldorf. Regisseur Frank-Patrick Steckel war schon zu seiner Bochumer Intendantenzeit in einem Punkte der Schrecken der schreibenden Zunft: Meist war es bei ihm auf der Bühne so düster, dass sich kein Kritiker Notizen machen konnte, sofern er nicht über einen dieser albernen Leuchtstifte verfügte. Nun hat Steckel am Düsseldorfer Schauspiel ein Terrain tiefster Finsternis aufgetan. Das Stück heisst „Nacht“, und es bleibt in jeglichem Sinne dunkel.
Geschrieben hat es die als Lyrikerin äußerst sprachmächtige und formbewusste, einer Droste oder Lasker-Schüler ebenbürtige Gertrud Kolmar (geboren 1894). Die Tochter eines jüdischen Rechtsanwaltes in Berlin, der sich gänzlich assimilierte und deutscher Patriot war, blieb auch nach 1933 im Lande, als dies bedrohlich wurde. Aufopferungsvoll unterrichtete sie taubstumme Kinder und pflegte ihren Vater. Ab 1941 war sie Zwangsarbeiterin in der Rüstungsindustrie. Im März 1943 wurde sie nach Auschwitz deportiert.
Das Stück „Nacht“ entstand 1938 und erfährt hier seine späte Uraufführung. Hauptperson ist Tiberius Claudius Nero, nachmals römischer Kaiser. Im Jahr 2 n. Chr. befindet er sich – mit einigen Gefährten – noch im selbstgewählten Exil auf Rhodos, derweil sein Stiefvater mitsamt Günstlingen in Rom herrscht.
Wir erleben diesen Tiberius als unerbittlichen Gottsucher. An der römischen Göttervielfait zweifelnd, befragt er mancherlei zweideutiges Orakel. Die Begegnung mit der jungen Ischta aus Judäa (die felsenfest an einen einzigen Gott glaubt) führt schließlich zu Szenen, die vollends fremd in unsere profanen Zeiten ragen.
Magische Sprache und ein Pathos der höchsten Werte
In einer erotisch getönten religiösen Aufwallung gibt sich Ischta dem Tiberius als Sklavin anheim, und er wird sie den höheren Mächten als Menschenopfer darbringen. Klar und einfach wie ein Quell sprechend, nimmt Ischta die vermeintliche Bestimmung auf sich. Eine unendlich zarte und doch überlebensgroße Figur, von Birgit Stöger mit bewegendem Ernst gespielt.
Dennoch ist das Ganze eine Gratwanderung am Rande des Unfassbaren, ein Opfergang bis zum Saum des Schwülstigen. Es ist jedoch auch ein erschütterndes Dokument der verzweifelten Suche nach jüdischer Identität in finstersten Zeiten. Dinge also, an die man gar nicht zu rühren wagt.
Somnambules Passionsspiel
Lange geriert sich Tiberius (Marcus Kiepe), der sich am Ende doch wieder in die Niederungen politischer Herrschaft begibt, weltenfern, abweisend und ziellos drangvoll zugleich. Ein Mann, an dessen Schicksal man keinen unmittelbaren Anteil nehmen kann, vielleicht gerade deshalb ein Faszinosum. Außerdem passen derlei Figuren wohl zur neuesten Unterströmung unseres Zeitgeistes, die sich von aller Ironie abwenden und ein neues Pathos der höchsten Werte aufrichten will.
Ein Botho Strauß fände vermutlich Gefallen daran; auch an einer immerzu ans Firmament greifenden Sprache, die mit kostbaren Wendungen wie „gunstbedeutender Traum“ und „tagverborgenes Geheimnis“ edelsten Tones einher wandelt. Die Magie der Worte fügt sich zum Klang-Ereignis jenseits eines sofort nachvollziehbaren Sinnes.
Das Bühnenbild (Johannes Schütz) zeigt düster zerklüftete Klippen, auf denen sich Menschen wie bleiche Geistwesen bewegen, stets auf die größten und letzten Dinge gefasst. Hier vollzieht sich ein somnambules Passionsspiel wie aus unvordenklichen Zeiten.
Steckel und sein Ensemble behandeln den immens schwierigen Text mit Noblesse. Zuweilen werden Worte nur behaucht, als könnten sie sonst klirrend zerbrechen. So umschifft man jede etwaige Peinlichkeit, und es kommt die Würde zum Vorschein, die dem Drama innewohnt.
Termine: 11., 22., 25. und 29. März. Karten: 0211/36 99 11.