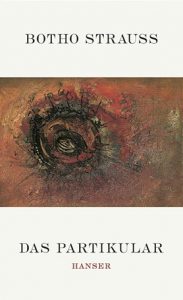Ein ungleiches Maler-Trio – Drei Wege zur Autonomie: Cézanne – Manet – Schuch in Dortmund
Von Bernd Berke
Dortmund. Das Wagnis ist nicht gering: Zwei berühmte Heroen der malerischen Moderne, nämlich Edouard Manet und Paul Cézanne, werden jetzt in Dortmund mit einer nahezu unbekannten Größe konfrontiert. Bange Frage: Können die Bilder des Österreichers Carl Schuch (1846-1903) dem direkten Vergleich überhaupt standhalten?
Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte, das mit dieser Schau den Abschluss umfangreicher Umbauten begeht, rühmt sich, besagtes Trio erstmals miteinander zu präsentieren. Das mag wohl sein. Auf diese riskante Idee ist eben noch niemand gekommen…
„Drei Wege zur autonomen Kunst“ – so der Untertitel – sind von den Künstlern beschritten worden. Belegstücke sind vornehmlich Stillleben (so viele Äpfel sah man wohl selten beisammen) sowie einige Landschaftsbilder. Als Zugabe sind ein paar sehr tiefgründige Gemälde von Gustave Courbet zu bewundern, der den anderen eine Leitfigur gewesen ist.
Die Lebendigkeit der Austern und Äpfel
Das Gros der Bilder stammt von Schuch, der einige Jahre in Paris gewohnt hat, den beiden Franzosen aber nie persönlich begegnet ist. Bestimmt war es leichter, diese Leihgaben zu bekommen, als noch mehr Werke von Manet und Cézanne. Denn der gebürtige Wiener Schuch, der zeitlebens vergebens auf Ausstellungen hoffte, darob verbitterte und umnachtet starb, ist selbst manchen Fachleuten kein Begriff.
Allen drei Malern ist dies gemeinsam: Die Gegenstände werden immer weniger realistisch nachgebildet, sie sind alsbald nur noch Anlässe zum freieren Spiel mit Flächen und Farben. Ein Apfel etwa, der vordem noch mit Händen zu greifen und essbar zu sein schien, verflüchtigt sich zunehmend zur farblichen Erscheinung. Am Horizont dämmert die Abstraktion herauf.
Ein Blick auf die Entstehungsjahre der Bilder beweist: Die vorher geborenen Manet (Jahrgang 1832) und Cézanne (geb. 1839) haben sich deutlich früher von den Gegenständen entfernt als Schuch (geb. 1846). Dies ist freilich noch kein Wert an sich.
Großes Talent, doch selten Vollendung
Der genauere Augenschein zeigt allerdings Qualitäts-Unterschiede: Manets 1862 geschaffenes Stillleben „Austern“ stellt die Köstlichkeiten grandios und geradezu dynamisch auf die Szene. Seine „Vier Äpfel“ nehmen Beziehungen zueinander auf wie quicklebendige Wesen. Nahrung für die Phantasie.
Oder: Wenn Cézanne etwa eine Obstschale malt, wählt er kühne und raffinierte Ausschnitte, schafft delikate Farbereignisse und erfasst stets den richtigen, den einzig möglichen Moment. Wie schön, dass man derlei Meisterwerke in Dortmund genießen kann! Der Schriftsteller Emile Zola hatte seinerzeit stark behauptet, eine gemalte Möhre könne eine Revolution auslösen. Fast möchte man es glauben.
Demgegenüber hat sich Schuch denn doch mühen müssen. Gewiss besaß er großes Talent, doch zur Vollendung hat er selten gefunden. Manche Bilder, wie etwa die „Sägegrube“ (1878), künden durchaus von Originalität. Bei seinen Stillleben ist es aber weniger die Malweise als die zuweilen etwas gesucht wirkende Kombination der Dinge, die von Eigenheit zeugt: „Rosen, Keksteller und Orange“, „Hummer, Zinnkanne und Spargelbund“; Ansichten aus der guten Küche, die den optischen Appetit schnell stillen und darüber hinaus auf nichts Wesentliches deuten.
Cézanne – Manet – Schuch. Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund (Hansastraße). 30. Mai-30. Juli. Di-So 10-18, Do 10-20 Uhr. Eintritt: 12 DM. Katalog 48 DM.