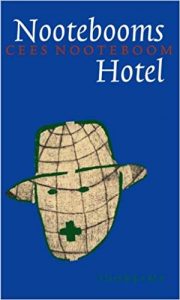Ein „Sturm“ im üblichen Rahmen – Shakespeares Drama am Dortmunder Schauspiel
Von Bernd Berke
Dortmund. Ganz träge bewegen sich die Gestalten auf dem schlingernden Schiff. Doch allmählich begreifen sie, dass der Kahn unterzugehen droht. Plötzlich wird aus Bräsigkeit helle Panik, es erhebt sich Geschrei, und das Wasser spritzt hoch – bis in die ersten Sitzreihen des Schauspielhauses.
„Der Sturm“ von William Shakespeare tobt mal wieder über die Bühne, seit Samstag herrscht schwere See in Dortmund. Sie lässt Neapels König Alonso samt Gefolge (darunter Antonio, unrechtmäßiger Herzog von Mailand) auf einem verlassenen Eiland stranden. Zauberkräftiger Beherrscher dieser Insel ist ausgerechnet Prospero, dem eigentlich Mailand zustünde, der aber vor zwölf Jahren von seinem Bruder Alonso schmählich auf offener See ausgesetzt wurde, mitsamt seiner kleinen Tochter Miranda.
Shakespeares mutmaßlich letztes Stück, schwankend zwischen heiterer Gelassenheit, Melancholie und Verzweiflung, lässt keine Rache zu. Der Büchermensch Prospero, Muster eines geistvollen Regenten, vergibt am Ende seinen einstigen Feinden und schwört aller magischen Macht ab. In Dortmund (Regie Hermann Schmidt-Rahmer/Bühnenbild Herbert Neubecker) verzeiht Prospero gleichsam zähneknirschend. Er ist der weltlichen Dinge müde, von Alters-Verzweiflung satt – und tröstet sich zum Sçhluss mit Dosenbier.
Das hier bisweilen eher tapsig als wundersam chaotisch wirkende Drama begibt sich auf sehr schräges Geläuf aus morschem Holz. Einige Planken werden herausgerissen, so dass Blicke ins buchstäblich „Bodenlose“ fallen. Man meint, derlei Bühnenaufbauten schon des Öfteren gesehen zu haben. In diesem Ambiente durchdringen einander die Welten: Hier Alonsos dümmliche Hofschranzen, da die von Prospero gezähmte Geisterwelt mit dem guten Laufwesen Ariel und dem bösen Erdling Caliban.
Ein Drang zur sinnreichen Form bleibt spürbar .
Beim oft simultanen Spiel wird es zuweilen eng auf der Bühne. Die Menschen sind niemals allein, sondern stets von Geistern und Träumen umfangen. Und beide Sphären sind geprägt von allerlei Knechtschafts-Verhältnissen; ein Umstand, den diese Inszenierung füglich betont. Doch allzu viel Erhellendes gewinnt sie dem Stoff so nicht ab, wie denn überhaupt ein Drang zur sinnreichen Form stets spürbar bleibt, doch Formvollendung sich nur selten einstellt. Mit der Zeit mag sich die Sache noch entwickeln. Die Premiere muss nicht das Maß aller Dinge bleiben.
Jede Figur bekommt ihre Attribute oder Schrullen zugeteilt, nicht immer erschließen sich die Motive: Prospero (Andreas Weißert) wandelt einher wie ein altgriechischer Philosoph, immer mehr bebenden Ernst in der Stimme, um bedeutsame Innigkeit bemüht. Alonso (Günther Hüttmann) ist kein König zum Aufschauen, sondern einer zum Knuddeln.
Wenn der Kulturlose in Büchern blättert
Gar gelenkig rollt und wälzt sich Prosperos nun 15-jährige Tochter Miranda (Birgit Unterweger) über den Bühnenboden – ein immerzu tollendes Kätzchen. So bezaubert sie Alonsos etwas unbedarften Sohn Ferdinand (Alexander Swoboda) und so weckt sie die Geilheit des wilden Caliban (hier die interessanteste Figur: Felix Römer). Der ach so Kulturlose wird ganz am Schluss in Prosperos Büchern blättern, und man darf raten: Paart sich hier Bosheit mit Wissensdurst, oder wird er sich zivilisieren?
Zwei Figuren gesellen sich dem Caliban zu wie eine brutale Ausgabe von Dick und Doof: Trinker (Sebastian von Koch) und Stephan (Rainer Galke), der eine ein arger Proll mit Bierdosen-Paletten und „saustarken“ Ballermann-Sprüchen, der andere ein feiger Depp mit österreichischem Zungenschlag. Es sind wandelnde Zugeständnisse ans Unterhaltungsbedürfnis, darin gar nicht so weit von Shakespeare entfernt.
Für Zauber und Poesie ist derweil der kahl geschorene, mit hellem Stimmchen singende Ariel zuständig, gespielt von Kindern (im Wechsel: Anna Bonkhoff, Christina Westermann), sehr lieb und somit nicht von dieser Welt. In ein solches Jenseits wären wir gern weiter entführt worden. Freundlicher Beifall im Rahmen des Üblichen. Er entsprach dem Anlass.
Termine: 24;, 26. November, 2., 17. und 29, Dezember. Karten: 0231/5027222.