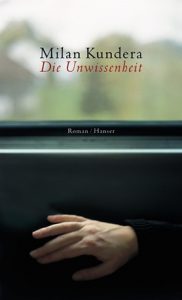Leise kommt der Jammer – Jürgen Kruse inszeniert Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“ in Bochum
Von Bernd Berke
Bochum. Da hat man vorher gewettet, welche Schätze der Regisseur Jürgen Kruse diesmal aus Rock- und Pop-Archiven heben würde, um sie mit ordentlichen Dezibel-Werten von der Bühne schallen zu lassen. Doch an dem fast vierstündigen Abend kommt es ganz anders.
Zwar setzt Kruse auch diesmal allerlei Musik (von Brenda Lee bis zu den Byrds) ein, doch nur als weiche Einbettung für den Text, den er mit großem Respekt vor dem Wortlaut inszeniert hat.
Auf dem Plan steht Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“ (Uraufführung 1949), jenes tragische, manchmal auch ein klein wenig sentimentale Spiel vom Scheitern des „kleinen Mannes“ und seines amerikanischen Traums vom ungehinderten Fortkommen.
Ärmliche Wohnung in Brooklyn; lauter noch nicht abbezahlte Ratenkäufe. Trotzdem wirken die Möbel schon aufgebraucht. Wie in eine Puppenstube schauen wir in die zwei Etagen dieser Behausung (Bühnenbild: Steffi Bruhn). „Draußen“ dräut eine Hochhaus-Silhouette, man hört hektisches Hupen. Keine gute Gegend. Links von der Bühne, grinst „Uncle Sam“, der das Dach von einem Hause hebt und so in die Privatsphäre dringt.
Den Träumen folgen keine Taten mehr
Hierher kehrt der Handlungsreisende Willy Loman (stille Größe im Leid: Jürgen Rohe) von einer kläglich erfolglosen Verkaufstour zurück. Er trägt einen verschlissenen braunen Anzug. Der Mann spricht leise, mit brüchiger Stimme, die Schultern hängen herab. Sein ganzes Wesen ist nur noch ein mühsam wankendes Aufrecht-Erhalten, steifbeiniger Rest einer längst verbrauchten Würde. Ein Satzfetzen wird immer wieder gemurmelt: „Waagerecht oder senkrecht“. Ja, das ist hier die Frage: Wie sich einer im Kreuzworträtsel des Lebens noch behaupten kann, wenn alle Felder falsch ausgefüllt sind.
40 Jahre lang hat Willy der Firma gedient, nun kann er nicht mehr. Die beschädigten Träume ergießen sich nicht mehr in Taten, sondern bloß noch in (Selbst-)Gespräche. Phantasien von Großartigkeit („Ich bin überall beliebt“) wechseln mit Jammer („Man findet mich lächerlich“). Was einst Selbstentwurf war, ist nur noch Selbstbetrug und mündet schließlich in Selbstaufgabe. Ein „Versager“ in den Zeiten des Börsenwahns. Rings um ihn verdichtet sich ein simultanes Geisterspiel, eine Art „Gespenstersonate“. Die Traumlicht-Erscheinung des „im Dschungel“ reich gewordenen Bruders Ben (Ralf Dittrich) lockt Willy ins gefährlich Ungefähre.
Kruse lässt Millers Text in aller Ruhe dahin rinnen, er zerfleddert nichts, sondern lotet leise, umsichtig und mitleidend aus. So sehr hat er sich als Regisseur zurückgenommen, dass man gelegentlich gar ein paar rhythmische Akzente vermisst, die den Energiefluss stauen und wieder freisetzen könnten.
Am Ende tobt sich doch noch die Spaßgesellschaft aus
Präzise sezieren Kruse und seine Darsteller auch das freilich nicht rein „private“ Familien-Syndrom der Lomans: Da ist Linda (Veronika Bayer), die ihren Mann, trotz all‘ seiner Schwächen liebt, eine Heroine des Alltags im Morgenrock; da sind die Söhne Biff und Happy (Patrick Heyn, Johann von Bülow), noch jugendlich hitzig und albern, doch auch schon gebrachen. In ihrem Widerspiel mit dem Vater spürt man schaudernd die allzu kurze Spanne des Lebens: kaum gehofft, schon halb gescheitert. Generation für Generation.
Und die Musik? So behutsam verwendet wie hier, nimmt sie Stimmungen auf und trägt sie sanft weiter. Nur ganz am Schluss dröhnt, nach Willys Autounfall-Tod, eine Party mit dem „Starfucker“ der Rolling Stones. Fühllos stampft die Generation der Lebensversicherungs-Erben übers triste Schicksal des Handlungsreisenden hinweg. Da tobt sich die Spaßgesellschaft im Jugendwahn aus.
Frenetischer Beifall für alle.
Termine: 28. Mai, 17., 25. Juni. Karten: 0234/3333-111.