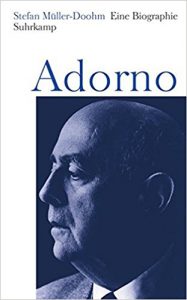So will es das Klischee: Jeder „große Mann“ muss der Nachwelt mindestens einen Satz hinterlassen, den viele zu kennen meinen; besser noch, wenn der Ausspruch Rätsel aufgibt und die gesamte Existenz umgreift. Bei Theodor W. Adorno, der vor 100 Jahren (am 11. September 1903) geboren wurde, waren es diese Worte fürs kollektive Gedächtnis: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“
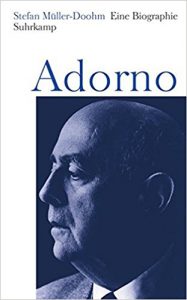
Man könnte sich den Sinn simpel zurechtlegen, etwa so: Wie man’s auch macht, man macht es verkehrt – in dieser unserer Gesellschaft. Adorno zufolge ist sie derart von Markt- undTausch-Verhältnissen durchwirkt, dass nichts und niemand sich dem Sog der „Verdinglichung“ entziehen kann. Also schlägt jedes Dasein letztlich fehl, alsogibt es nie und nimmer restlose Erfüllung. Wer sich für glücklich hält, irrt sich umso gründlicher, erliegt – um mit Adorno zu reden – der „Verblendung“. Ein bedrückender Befund, fürwahr. Und schweres, gewichtiges geistiges Gepäck!
Nur die würdigsten Werke der Kultur ließ er als Statthalter eines besseren Lebens gelten. Beispiel Musik: Der Mann mit dem absoluten Gehör, der zeitweise selbst als Komponist hervortrat,bewunderte und pries (ohne sonderliche Gegenliebe) anfangs den Zwölftöner Arnold Schönberg. Doch sobald der und seine Adepten um ein Jota vom Pfad der neuen Klangschöpfungen abwichen, setzte es beißende Kritik. Erst recht hielt der ansonsten tief in der deutschen Hochkultur des 19. Jahrhunderts wurzelnde Adorno absolut nichts vom Jazz. Von den Nazis in die britische, dann in die US-Emigration getrieben, glaubte er in Jazz-Rhythmen gar unterschwellig den Marschritt der SA-Stiefel zu hören. Da dürfte er sich, aus guten Gründen überempfindlich geworden, denn doch vertan haben.
Adorno, als Philosoph und Sozialwissenschaftler eine Jahrhundert-Gestalt, gilt als ungemein strenger und weitgehend pessimistischer Denker. Kein Phänomen, dass er ungeschoren hätte gelten lassen. Berühmt wurde seine Äußerung, „nach Auschwitz“ überhaupt noch Gedichte zu schreiben, sei „barbarisch“. Damit meinte er keineswegs nur Liebes- oder Heimatlyrik. Als er das schrieb, kannte er bereits die Werke von Paul Celan und Nelly Sachs, die das unnennbare Grauen dennoch in aller Zerrissenheit zu fassen suchten. Immer noch streiten sich die Gelehrten, ob Adorno sein Gedichte-„Verbot“ später gemildert habe. In ausgiebigen Umfrage-Forschungen hatte Adorno jedenfalls in Kalifornien den „Autoritären Charakter“ dingfest gemacht: starr, unnachgiebig, mit Vorurteilen beladen, zum „Führerprinzip“ und Faschismus neigend.
Tatsache ist: Die keinen Widerspruch duldende Auffassung, dass von Auschwitz her alles, aber auch wirklich alles neu überdacht werden müsse, hat Adorno zu einem der geistigen Gründerväter der Bundesrepublik gemacht. Heute speist sich so manches politische Handeln aus diesem Denken, dieser Haltung.
Zudem war Adorno ein wesentlicher Vordenker der APO-Revolte um 1968, deren radikalste Kräfte ihn hernach beiseite schieben wollten. Sozusagen mit Marx- und Engels-Geduld war er zu Diskussionen bereit. Doch es half ihm nichts, die Aktionisten setzten sich durch: Das von Max Horkheimer und Adorno geleitete, schon in Vorkriegszeiten ruhmreiche Frankfurter Institut für Sozialforschung wurde von Studenten besetzt und musste polizeilich geräumt werden. Zur Legende wurde das „Busen-Attentat“ dreier ach so linker Studentinnen, die sich vor dem höchst verunsicherten Adorno entblößten und ihn peinlich bedrängten. Welch ein Debattenbeitrag! Man wüsste nur zu gern, was später aus diesen physisch „argumentierenden“ Damen geworden ist.
Bis hierher und nicht weiter! Man könnte ja denken, Adorno sei allzeit unnahbar, streng und finster, ja geradezu lebensfeindlich gewesen. Nichts da! Zumindest häufen sich die vermeintlichen Widersprüche, so dass auch zwei neue Biographien (Angaben am Schluss) gelegentlich fast ins „Tratschen“ geraten: Der Mann konnte eben auch sehr entspannt sich geben. Den Jazz, den er angeblich so geschmäht hat, improvisierte er zuweilen selbst auf dem Klavier. Gern hat „Teddy“, wie Freunde ihn liebevoll nannten, mit anderen Professoren und Studenten in Frankfurt feuchtfröhlich gefeiert. Auch war er den Reizen weiblicher Schönheit keineswegs abgeneigt. Im Gegenteil: Großmütig toleriert von seiner Frau Gretel (promovierte Chemikerin, die ihm ohnehin den Rücken fürs ungestörte Arbeiten freihielt), hat er sich immer mal wieder in erotische Abenteuer verstrickt, und zwar alles inklusive. Und um das allzumenschliche
Maß zu füllen: Der leidenschaftliche „Bergmensch“ Adorno (am 6. Auhust 1969 starb der Erschöpfte nach einer Wanderung nah bei seinem Lieblingsgipfel, dem Matterhorn) hielt sich nicht nur gern im Frankfurter Zoo auf, sondern liebte die ZDF-Serie „Daktari“ mit dem Löwen Clarence und der Äffin Judy dermaßen, dass niemand ihn dabei stören durfte…
Auch gedanklich schritt Adorno selten stur geradeaus. Bei ihm, dem subtilen und wortmächtigen Dialektiker, enthielt vielmehr jede Wahrheit auch ihre Gegenthese und konnte „umschlagen“, sich also grundlegend verändern und den Verhältnissen anschmiegen. Seinem funkelnden, auch sprachlich ungeheuer geschmeidigen Verstand konnte sich beispielsweise auch ein Botho Strauß nicht entziehen. Der Dichter und Dramatiker notierte 1981 in seinem hellsichtigen Episoden-Band „Paare Passanten“ über Adorno: „Wie gewissenhaft und prunkend gedacht wurde, noch zu meiner Zeit! Es ist, als seien seither mehrere Generationen vergangen.“ So dürfte denn auch Adornos famose Aphorismen-Sammlung „Minima Moralia“ (die wohl ideale Einstiegs-Lektüre in sein Werk) auch Strauß als Musterstück gedient
haben.
Besagte Biographien sind spannend zu lesen, allen unterschiedlichen Ansätzen zum Trotz (Lorenz Jäger geht eher kritisch mit Adorno ins Gericht, Stefan Müller Doohm folgt sehr einlässlich seinen Wegen). Neidvoll erfährt man, wie die Eltern (Sängerin, Weinhändler) den Jungen allseits gedeihlich förderten und gewähren ließen. Vor allem aber: Adornos Begegnungen (und Reibereien) mit anderen linken „Ikonen“ wie Bert Brecht, Ernst Bloch, Herbert Marcuse, Walter Benjamin und Siegfried Kracauer zählen zum geistigen Kern-Geschehen des 20. Jahrhunderts, desgleichen seine harsche Auseinandersetzung mit dem so anders gearteten Philosophen Martin Heidegger und dessen verstiegener Sprache („Jargon der Eigentlichkeit“).
Schließlich jenes Lehrstück der Eitelkeiten und Empfindlichkeiten, das sich zwischen ihm und Thomas Mann
entfaltete: Adorno hatte den Nobelpreisträger denkbar intensiv in musikalischen Fragen beraten, als der Teufelspakt-Roman „Doktor Faustus“ über den Tonsetzer Adrian Leverkühn entstand. Zuerst voll des Lobes über Adornos fachkundige Klugheit, wollte Mann später nicht mehr allzu viel davon wissen und den Ruhm lieber allein ernten. Dabei hatte Mann ganze Adorno-Passagen nur unwesentlich verändert einmontiert. Verständlich, dass Adorno auf Klarstellung drängte. Das wiederum fand Thomas Mann nur noch lästig. Auch die größten Männer benehmen sich manchmal wie kleine Kinder.
Lorenz Jäger: „Adorno. Eine politische Biographie“. Deutsche Verlagsanstalt, München. 319 Seiten. 18,90 Euro.
Stefan Müller-Doohm: „Adorno. Eine Biographie“. Suhrkamp Verlag. 1032 Seiten mit
ausführlichem Anhang. 38 Euro.
(Der Beitrag stand am 6. September 2003 in leicht verkürzter Form in der „Westfälischen Rundschau“)