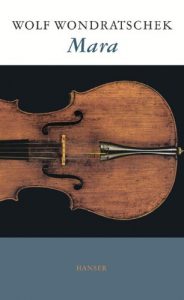Flimm will Triennale im Spätsommer – Künftiger Festival-Chef stellte sich in Bochum der Presse vor
Von Bernd Berke
Bochum. Sonnenklar: Jürgen Flimm, ab 2005 Chef der RuhrTriennale, hat erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag unterzeichnet und kann noch nicht mit fertigen Festival-Konzepten aufwarten. Doch er skizzierte gestern in Bochum schon mal „Ideen aus meinem Zettelkästen“.
So kann er sich etwa Programme auf der Basis von Renaissance- und Barock-Kompositionen vorstellen. Diese Epochen lägen uns innerlich gar nicht so fern: „Auch damals mussten neue Horizonte entworfen werden.“ Apropos: Ein alle Produktionen überspannendes Grundthema sei in unseren Umbruch-Zeiten kaum vorstellbar. Flimm: „Es herrscht Zersplitterung.“ Aber vielleicht ergebe sich ja ohne Absicht eine heimliche Leitidee.
„In Salzburg ist man altgierig, im Revier neugierig“
Flimm, der bei der RuhrTriennale nicht selbst inszenieren will, nannte zwei konkrete Wünsche: Schon seit längerem reize ihn Bernd Alois Zimmermanns Oper „Die Soldaten“ (nach J.M.R. Lenz). Auch für Luigi Nonos bislang fast nur konzertant gegebenes Musikdrama „Prometeo“ will Flimm eine theatralische Umsetzung anregen: „Konzertant ist doch eunuchenhaft.“ Gut möglich also, dass derlei Stoffe das Fundament für „Kreationen“ bilden, wie sie Flimms noch amtierender Vorgänger Gerard Mortier ersonnen hat: tiraditionelle Formen als Ausgangsmaterial für neue Mischungen und Erkundungen. Überhaupt zollt Flimm dem Belgier großen Respekt. Und er schwärmt vom Revier-Publikum: „In Salzburg ist man altgierig, hier im Revier ist man neugierig.“
Überhaupt keine Probleme mit Castorf
Weit gediehen sind Flimms Überlegungen, die RuhrTriennale im Sinne einer Entzerrung zeitlich neu zu postieren. Der Schwerpunkt soll nicht mehr im Frühjahr oder Herbst liegen, wenn etliche andere Festivals und Premieren anstehen, sondern im Spätsommer. Vor allem dürfe es keine Überschneidungen mit den Ruhrfestspielen geben, die dann unter dem Triennale-Dach von Frank Castorf (Flimm: „Mit dem habe ich überhaupt keine Probleme“) geleitet werden.
Zudem zeichnet sich eine Konzentration auf noch weniger Spielorte ab. Flimm sieht die Bochumer Jahrhunderthalle als zentrales Festspielhaus. Daneben dürfte der Duisburger Landschaftspark Nord Bestand haben, wo Flimm gerade einen WDR-Film dreht – die Kleist-Phantasie „Käthchens Traum“.
„Kürzungsschock“ ist überwunden
Für Koproduktionen mit Stadttheatern ist Flimm prinzipiell offen. Allerdings: Die Häuser zwischen Dortmund und Oberhausen müssten in erster Linie gezielt für ihre Städte spielen. Die Triennale stehe nur für besondere Projekte bereit, sie sei keine zweite Subventions-Quelle für kommunale Bühnen. Flimm bekannte, er habe den „Kürzungsschock“ (38 statt 42 Mio. Euro für die Triennale 2005 bis 2007) überwunden, und er sehe Spar-Möglichkeiten. Die musikalische Reihe „Century of Songs“ werde er aber fortsetzen.
Und wie hält es der Fußballfan mit dem Revier? Flimm ist Anhänger von Werder Bremen und derzeit sauer auf Schalke, das den Hanseaten den Torjäger Ailton abspenstig macht. Flimm: „Ich werde mich wohl auf Borussia Dortmund zubewegen Da geht mein Freund Müller-Westernhagen auch immer hin.“