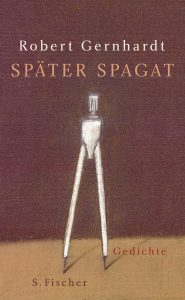Flimm: „Wir sind noch befreundet“: Nach Rollen-Absage erhebt Veronica Ferres Vorwürfe, doch Triennale-Chef bleibt gelassen
Von Bernd Berke
Zuerst hatte sich die Schauspielerin Veronica Ferres gar nicht weiter zu ihrer Rollen-Absage an die RuhrTriennale äußern wollen. Grund: Sie sei mit Triennale-Chef Jürgen Flimm befreundet. Jetzt freilich erhebt sie im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ, gestrige Ausgabe) recht bittere Vorwürfe gegen Flimm. Der wiederum empfiehlt im Gespräch mit der WR, die Sache niedriger zu hängen.
Flimm habe ihr die Triennale-Produktion „Courasche oder Gott lass nach“ als Chance zu einer großen Charakterrolle schmackhaft gemacht, so Ferres in dem FAZ-Interview. Der Büchner-Preisträger Wilhelm Genazino sollte ihr das Stück eigens „auf den Leib“ schreiben. Im Juni habe sie die bis dahin fertigen Passagen des Dramas gelesen, dessen (einzige) Hauptfigur eine alternde Hure ist. Sie sei erschrocken und enttäuscht gewesen.
„Es geht ums ,Ficken’…“
Veronica Ferres zur FAZ über ihren Schock: „Um es deutlich zu sagen: Es geht ums ,Ficken‘, es geht seitenlang um Sperma…“ Die Absprachen mit Flimm seien seinerzeit in eine ganz andere Richtung gegangen. Ferres wörtlich: „Ich komme mir ein wenig vor wie die Figur im Stück – die Männer bestimmen: Friß oder stirb, du mußt die Beine breit machen.“
Wenn solche Aussagen im Raum stehen, sollte man denn doch die „andere Seite“ hören. Die WR erreichte Jürgen Flimm gestern telefonisch in Salzburg. Flimm: „Das Stück war doch noch nicht einmal fertig. Veronica hat den dritten Akt überhaupt noch nicht gekannt. Sie wusste gar nicht, wie sich die Figur am Ende entwickelt. Sie war viel zu ungeduldig mit ihrer Absage. Aber bitte: Sie hat natürlich das Recht zu einem solchen Schritt.“
Keinerlei Anlass für Rechtshändel also, zumal sich die Verluste für die Triennale in engen Grenzen hielten. Flimm: „Wir reden hier gerade mal über sechs von etwa 100 Triennale-Vorstellungen.“ Und man habe die Produktion ja frühzeitig stoppen können.
Der Text war noch gar nicht fertig
Jedenfalls, so Flimm, hätte es durchaus Möglichkeiten gegeben, den Text hie und da noch zu ändern: „Das ist theaterüblich. Ein Autor liefert die Textvorlage, dann geht es an die weitere Arbeit.“ Besonders den ersten Akt habe er selbst „sehr gut“ gefunden, ein paar Stellen hätten aber auch für seine Begriffe etwas zu deftig geklungen. Genazino wäre allerdings bereit gewesen, das Eine oder Andere zu streichen. Außerdem, so Flimm: „Ich könnte Sätze aus Becketts ,Warten auf Godot‘ zitieren, da käme einem das Stück ganz obszön vor. Oder nehmen Sie Shakespeares ,Titus Andronicus‘, da geht es richtig zur Sache…“
Was sagt Flimm zu Ferres‘ Vermutung, die RuhrTriennale hätte ihre Popularität als Verkaufsmagnet einsetzen wollen? Der Triennale-Chef: „Das stimmt überhaupt nicht. Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde lang erzählen. Aber ich lasse es lieber.“
Ferres behauptet auch, man habe ihr anwaltlich verboten, öffentlich aus dem Genazino-Stück zu zitieren. Flimm: „Auch nicht richtig. Es ist gar nicht nötig. Hier greift schon das bloße Urheberrecht, solange ein Autor seinen Text noch nicht freigegeben hat.“ Die FAZ zitiert Veronica Ferres schließlich mit dem Satz: „Flimm hat mir geschrieben, daß es keinerlei Berührungspunkte mehr geben wird in unserem Leben.“ Jürgen Flimm zur WR: „Unsinn! Ich möchte mal wissen, woher sie das hat. Ich sehe es so, dass wir immer noch miteinander befreundet sind.“
Vielleicht wär’s Zeit für eine Aussprache zwischen den beiden? Flimm: „Die wird es wohl geben. Wir werden uns irgendwann mal im Café zusammensetzen und reden.“ Wahrscheinlich dann, wenn über die Angelegenheit ein wenig Gras gewachsen ist.
_________________________________________________
HINTERGRUND
Ersatz für „Courasche“ wird gesucht
- Nach der Absage von Veronica Ferres hat Triennale-Chef Jürgen Flimm die Duisburger „Courasche“-Produktion gestoppt. Es wird ein Ersatzstück gesucht.
- Flimm hatte Ferres die Rolle Ende 2005 offeriert.
- Wilhelm Genazino, Autor des strittigen Stücks, wurde 1943 geboren. Er war u. a. Redakteur beim legendären Satireblatt „Pardon“, ist seit 1971 freier Schriftsteller und bekam 2004 den Büchner-Preis. Genazino schrieb u. a. „Abschaffel“ (Trilogie, 1977), „Das Licht brennt ein Loch in den Tag“ (1996) und „Die Liebesblödigkeit“ (2005).
- Der Barockdichter Grimmelshausen lieferte den „Courasche“-Stoff, den auch Bert Brecht nutzte.