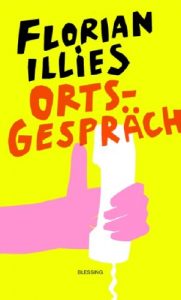Wo ist denn bloß der Bär geblieben? – Köln: Musical „Die 13 1/2 Leben des Käpt’n Blaubär“ nach Walter Moers uraufgeführt
Von Bernd Berke
Köln. Es beginnt vielversprechend: Käpt’n Blaubär sitzt gemütlich im Sessel und schickt sich an, auf gut Hamburgisch sein Seemannsgarn zu spinnen. Ganz so, wie wir ihn kennen und ins Herz geschlossen haben. Strahlende Vorfreude bei 1400 Zuschauern im Musical-Zelt am Kölner Südstadion: Das wird bestimmt ein feiner Abend!
Dann jedoch nimmt die Sache musikalische Fahrt auf und verliert im Getümmel zusehends die Fährte des Bären. Anders als vorab auf Probenfotos zu sehen, legt Blaubär-Darsteller Björn Klein gleich die drollige Tiermaske ab und agiert fortan als ganz gewöhnlicher, etwas naiver junger Mann, der halt eine blaue Hose und einen roten Pullover trägt. Sein Bärendasein ist nur noch bloße Behauptung.
Der Regisseur mag nichts riskieren
Gewiss: Grundlinien aus Walters Moers‘ phantasiereichem Buch-Bestseller „Die 13 1/2 Leben des Käpt’n Blaubar“ finden sich auch im gleichnamigen Musical wieder. Der Lügenbold erlebt schier unglaubliche Abenteuer mit Zwergpiraten, geschwätzigen Tratsch-Wellen, dem Rettungs-Saurier „Deus X. Machina“, dem bösartigen Stollentroll (bester Darsteller: Nik Breidenbach) und etlichen weiteren Fabelwesen. Hübsch groteske Figuren und Kostüme gibt es in dieser Menagerie zu sehen. Überhaupt sind die visuellen Effekte mitsamt computeranimierten Hintergründen bereits das Gipfelglück der Unternehmung. Immerhin ein wesentlicher Faktor.
Aber: Fast alles, was im umfänglichen Roman subtil und liebevoll ausgeschmückt war, erscheint in diesem Musical wie eingeebnet. Der herrlich skurrile Geist der Vorlage weht nur noch als Hauch, die parodierten Mythen (Atlantis & Co.) werden verscherbelt. Regisseur Zapo Schwalbe folgt meist ausgetretenen Pfaden des Genres, er riskiert nahezu nichts – und das bei diesem außergewöhnlichen Stoff!
Die Texte sind nicht immer unfallfrei
Die von Martin Lingnau mit professioneller Routine komponierte Musik (vom Band) bedient sich rundum, sie zitiert z. B. Shantys, Tango und Reggae, vor allem aber das globalisierte Rock-Idiom in den üblichen Ausprägungen. Die Skala reicht bis zur Schnulze („Blau muss mein Geliebter sein“). Manche Passagen hören sich halbwegs schmissig an, doch ein richtiger Hit, der sich sofort einprägen würde, ist nicht dabei. Das Reimschema der Liedtexte (Heiko Wohlgemuth) kommt auch nicht immer unfallfrei um die Satzkurven. Wenn man schon einmal ins Nörgeln geraten ist: Einige Szenen („Nachtschule“) kommen kopf- und gestaltlos daher, sie erschöpfen sich im wirren Gewusel. Zudem war der Ton zur Premiere phaserinweise noch unvollkommen ausgesteuert. Manches klingt seltsam gedämpft und mehlig. Bedauerlich für die Sänger. Sie geben sich alle Mühe.
Einige Nebensachen des Romans werden in den Vordergrund gezogen: So gerät der superkluge Prof. Abdul Nachtigaller, im Buch vorwiegend mit seinen Lexikon-Artikeln über das Wunderland Zamonien präsent, zum Moderator des Abends – als landläufig zerstreuter Professor. Nicht sonderlich originell.
Natürlich wird (im Bann der Musical-Konventionen) Blaubars Hang zum Blaubärenmädchen länglich und süßlich ausgespielt: „Für Dich koch‘ ich den Ozean ein / Nur mit den Flammen meiner Liebe“, trällern sie. Am Schluss regnet es Goldflitter auf die beiden herab. Ach, wie herzig!
Der genialische Blaubär-Schöpfer Walter Moers (siehe Info-Kasten) soll lange gezögert haben, ehe er die Musical-Rechte an seiner Figur vergab. Angesichts der Kölner Bescherung war seine Nachgiebigkeit wohl ein Fehler. Vielleicht hat er beim Kassieren entnervt gedacht: Lasst mich künftig in Ruhe und macht doch, was ihr wollt. Aber hätte er dann nicht ein Stückchen seiner Seele verkauft – und noch dazu das Fell des blauen Bären?
Bis 14. Januar 2007 Köln (Festplatz/Zelt am Südstadion, Vorgebirgsstraße). Tour-Stationen 2007: Frankfurt (ab 15. Februar), Hamburg (Mai), Berlin (August) und München (Nov.). Ticket-Hotline 01805 / 85 38 86.
_________________________________________________
ZUR PERSON
Drastische Figuren
- Walter Moers wurde 1957 geboren.
- Er lebt und arbeitet sehr zurückgezogen, gibt praktisch keine Interviews und lässt sich nicht fotografieren.
- Sein „Blaubär“ tauchte erstmals 1988 auf.
- Der Roman „Die 13 1/2 Leben des Käpt’n Btaubar“ (1999) sollte die ursprünglich für Kinder gedachte Figur auch Erwachsenen nahe bringen. Mit Erfolg: Das Buch verkaufte sich 750 000 Mal.
- Weitere, durchweg drastische Moers-Figuren: „Das kleine Arschloch“, „Der alte Sack“ und „Adolf (die Nazisau)“ – Hitler als lächerliche Comic-Gestalt, ganz gezielt an den Grenzen des Geschmacks angesiedelt.