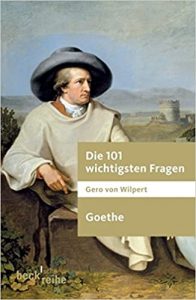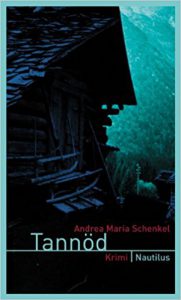Melancholischer Reigen der einsamen Menschen – Kinofilm „Herzen“ vom Altmeister Alain Resnais
Von Bernd Berke
Schnee. Schnee. Schnee. An den Nahtstellen dieses Films schneit es unentwegt; nicht nur draußen, sondern häufig – so wirkt es – bis in die Zimmer hinein. Doch obwohl Altmeister Alain Resnais in „Herzen“ lauter einsame Menschen zeigt, fallen die Flocken nicht etwa als Zeichen für Seelenkälte.
Vielmehr gibt das weiße Gestöber der Bilderfolge eine durchweg flüchtige Gestalt. Ein weiteres, häufig wiederkehrendes Element der festeren Art sind jene Wände und Gitter, hinter denen die Menschen sich hier häufig verbergen. Dass keiner sich preisgeben mag, ist insgeheim ein Hauptthema dieses großartig besetzten, formbewussten und vielschichtigen Films.
Die episodische Handlung ist als Reigen aus 54 Sequenzen angelegt. Fast kaum zu glauben, dass die Theater-Vorlage vom britischen Komödien-Vielschreiber. Pariserisch ist das Flair, alles Britische wurde getilgt, Melancholie weht durch jede Szene.
Nicole (Laura Morante) und Dan (Lambert Wilson als arbeits- und antriebsloser Mann, der stets in derselben Bar versackt) sind reif für die Trennung. Trotzdem suchen sie noch halbherzig eine neue Wohnung. Quälend die fruchtlosen Besichtigungen. Herzzerreißend ihr Unvermögen, miteinander zu reden.
Nach religiösen Liedern kommt der heiße Striptease
Die Handlung gleitet nun hin und her – zunächst zum etwas linkischen Wohnungsmakler Thierry (André Dussollier). Er lebt neben seiner nicht minder einsamen Schwester Gaëlle (Isabelle Carré) her, die abends in Lokalen trübsinnig auf Annoncen-Bekanntschaften wartet. Der Makler himmelt unterdessen seine Kollegin Charlotte (Sabine Azéma) an. Die wiederum ist fromm, hegt aber eine heimliche Lust an der Versuchung: Erst inständig beten, um sich dann der Sünde auszuliefern. Charlotte leiht dem Makler Video-Kassetten mit religiösen Liedern. Doch wenn die aufgenommenen TV-Sendungen enden, beginnt plötzlich ein heißer Striptease mit Gestöhne. Sollte sie etwa selbst…?
Barkeeper Lionel (Pierre Arditi), bei dem besagter Dan Stammgast ist, braucht mal wieder eine neue Pflegerin für seinen kranken, immerzu Obszönitäten sabbernden Vater – und engagiert just Charlotte für die langen Abende. Wie die ach so fromme Frau wohl mit dem polternden Lustgreis zurande kommt?
Gebannt verfolgt man, wie all diese Verlorenen und Vergessenen in die Ascheresten ihrer Gefühle pusten. Um jede Figur herum gibt es so etwas wie einen Strahlenkranz der Einsamkeit. Doch eine freundliche Geste genügt, um ihre verborgenen Hoffnungen zu wecken. Vor Verletzungen flüchten sie in Verzicht, Lüge und Versteckspiel. Man ahnt: Samt und sonders haben sie viel mehr Leben in sich, als sie zeigen können. All das lässt dieser Film mit weiser Zurückhaltung anklingen. Unaufdringlich, daher doppelt eindringlich.