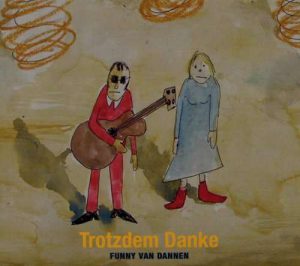Paul Wunderlich: Magie als Markenzeichen
Selm/Cappenberg. Der Hamburger Künstler Paul Wunderlich (80) ist aus dem Fokus der großen Museen nahezu verschwunden. Umso erstaunlicher diese antizyklische Tat: Jetzt richtet ihm der Kreis Unna auf Schloss Cappenberg eine geradezu überbordende Retrospektive mit 350 Arbeiten aus.
Thomas Hengstenberg, Leiter des Fachbereichs Kultur beim Kreis, spricht gar von einer „Materialschlacht” oder (weniger martialisch) von „barocker Fülle”, die in Cappenberg angerichtet werde. Nicht nur Gemälde sind zu sehen, sondern auch Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen, Schmuck und Möbel aus Wunderlichs Werkstatt. Ein pralles Sammelsurium. Der größte Leihgeber ist zugleich Kooperationspartner: das schleswig-holsteinische Landesmuseum Schloss Gottorf.
Paul Wunderlich gilt als „magischer Realist”. Will ungefähr heißen: Seine Figuren sind genauestens erkennbar, doch sie sind meist in phantastischen, (alp)traumnahen Situationen angesiedelt. In den letzten 20 Jahren, die hier vorüberziehen, hat sich am Stil nicht viel geändert. Auch bleibt das Spektrum der Ausdrucksformen relativ schmal. Man erlebt quasi „Markenzeichen”-Kunst, unverkennbar in sich gefestigt. Gänzlich neue Inspirationen lodern hier nicht. Gedämpfte Magie.
Formal klingt Surrealismus nach, farblich mischen sich Reminiszenzen an kunterbunte Pop-Art hinein. Wie weit liegt das alles zurück! Man fremdelt. Vor allem dann, wenn die Ausführung gar zu dekorativ und gefällig gerät. Selbst ein Bildnis dreier Schreckensherrscher (Hitler, Stalin, Mao) wirkt harmlos.
Übergänge zum (ehrbaren) Kunstgewerbe sind an manchen Stellen fließend. Gewiss: Einzelne Arbeiten durchbrechen die Begrenzungen. Rein handwerklich besehen, ist Wunderlich ohnehin eminent akribisch. Doch spannender wird’s, wenn er „bloß” genialisch skizziert und nicht penibel ausgestaltet.
Wiederholt hat sich Paul Wunderlich in traditionellen Beständen umgesehen. So malte er Paraphrasen (doch keineswegs Parodien) auf berühmte Bilder etwa von Cranach und Holbein oder aus der galanten Schule von Fontainebleau. Er überführt die Motive offenbar ziemlich reibungslos in seine eigene Welt. Wunderlichs Versionen wirken allemal „glatter” und somit steriler als die Vorbilder. Charakterfiguren gerinnen bei ihm rasch zu fast neutralen Emblemen.
Eros und Tod kristallisieren sich als althergebrachte, gar nicht so geheime Zentren dieser Bilder heraus. Wunderlichs Frauengestalten besitzen oft eine derart forcierte erotische Oberflächen-Aura, dass die männlichen Wesen nur noch gebannt starren.
Man könnte also angesichts dieser Kunst die eine oder andere Obsession ein wenig spazieren führen. Doch man dürfte kaum aufgewühlt sein. Erregung und Erschütterung fühlen sich anders an.
Paul Wunderlich – „Poesie und Präzision”. Schloss Cappenberg in Selm-Cappenberg. 2. September bis 2. Dezember. Di-So 10-17 Uhr. Eintritt frei, Katalog 24,90 €. Ganz neu im Schloss: ein kleiner Museums-Shop.