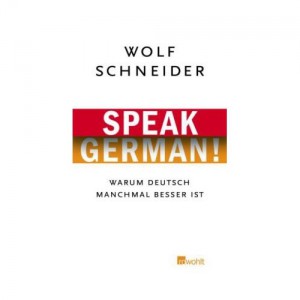Die Welt besteht aus Zahlen – eine anregende Ausstellung in Paderborn
Paderborn. „Am Anfang war das Wort”. Wirklich? An dem biblischen Satz könnte man zweifeln, wenn man diese Ausstellung gesehen hat: „Zahlen, bitte!” zeigt unsere Welt als Ansammlung berechenbarer Verhältnisse. Wie schon der alte Grieche Pythagoras gesagt haben soll: „Die Zahl ist das Wesen aller Dinge.”
Viele kokettieren ja gern mit ihrer Unkenntnis auf diesem Felde: „In Mathe war ich immer schlecht!” Doch 2008 ist nun mal hochoffiziell zum „Jahr der Mathematik” ausgerufen worden. Und nicht nur der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger mahnt seit längerem, diesen Teil der Kultur bloß nicht zu vernachlässigen. Also ist tätige Reue fällig: Auf nach Paderborn, auf ins Heinz Nixdorf Museum!
Da merkt man rasch: Was immer uns ästhetisch erfreut, hat letztlich mit Zahlen zu tun. Der Aufbau schöner Kristalle, die Symmetrie der Tiere, überhaupt die Schauspiele der Natur – mathematisches Regelmaß. Musikalische Klänge – im Grunde lauter Zahlenwerk. Gemälde und Architektur nach dem „goldenen Schnitt” – kaum denkbar ohne rechnerische Basis.
Reichlich Gelegenheit
zum Ausprobieren
Immer wieder gibt es Gelegenheit zum Mitmachen und Ausprobieren, vor allem im „Zahlenzirkus”, der Kinder begeistern soll. Doch diese auch für Erwachsene anregende Schau begnügt sich nicht damit, Staunen und Spieltrieb zu bedienen. Mit sinnlichen Belegstücken dringt sie hie und da auch etwas tiefer in die Materie ein.
Es gibt knappe Einführungen in Geheimnisse der so genannten irrationalen und der komplexen Zahlen, auch die Kreiszahl Pi oder Fibonacci-Zahlenreihen werden näher betrachtet. Man begegnet den großen Rechenkünstlern und Zahlenjongleuren der Geschichte. Hinzu kommen völkerkundliche Exkursionen: Ganz unterschiedliche Zahl- und Zählsysteme gab es auf dem Erdenrund. Im alten Babylon etwa pflegten die Menschen ein 60er-System, dessen Relikte uns heute noch durch Stunden- und Minuteneinteilung geläufig sind. Und das gedankliche Vordringen in den Null- und Minus-Bereich ist ein echtes geistiges Abenteuer.
Vollends verblüffend ist die in Paderborn gezeigte „Unendlichkeitsmaschine”, deren erstes Zahnrad sich noch sichtlich schnell bewegt. Es übersetzt seine Kraft aufs nächste, das sich schon deutlich langsamer dreht. Und so weiter, bis das letzte Rad erreicht ist. Für eine einzige Rotation, so die mathematische Vorausberechnung, würde es 2,3 Billionen Jahre brauchen. Bis dahin ist manches vorbei.
Besonders alltagsnah ist die Abteilung, die sich dem Zufall (sprich: Wahrscheinlichkeitsrechnung) und dem Glücksspiel widmet. Spielgeräte, (gezinkte) Würfel und die alte ARD-Lottotrommel (bis 1965 in Gebrauch) sind Blickfänge.
Beim Glücksspiel wird
es häufig kriminell
Stellenweise wird’s hier kriminell. Oft gab es Versuche, das Zahlenglück zu überlisten, beispielsweise mit Magnetwellen per Handy die Roulettekugel zu lenken. Der Croupier musste sie allerdings vorher ausgetauscht haben. Mathematisch betrachtet, kommt jede Zahl auf Dauer in etwa gleich häufig, ob beim Lotto oder am Spieltisch. Würde man theoretisch ewig spielen, wäre ein Reingewinn unmöglich. Man muss eben rechtzeitig aufhören.
Schon zu Beginn der Schau wird man – noch auf der Rolltreppe – mit einem gesprochenen Countdown empfangen: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Am Schluss erfährt man noch einmal in geballter Form, dass schier alles zählbar zu sein scheint und daher auch gezählt wird. Statistiker haben errechnet, dass im Schnitt stets 0,7 Prozent der Weltbevölkerung volltrunken sind. Diverse Geräte vermessen nicht nur die ganze Erde oder den Stromverbrauch, sondern es gibt auch Zählwerke, die Springseil-Umdrehungen ermitteln.
Eine mathematisch inspirierte Kunst-Installation rechnet schließlich Gestalt und Bewegungen der Besucher in wabernde Zahlenwolken um und zeigt sie auf der Leinwand – fürwahr ein seltsamer Blick in den „Spiegel”.
„Zahlen, bitte! – Die wunderbare Welt von null bis unendlich”. Heinz Nixdorf MuseumsForum, Paderborn, Fürstenallee 7 (umfangreiches Begleitprogramm – Tel.: 05251/30 66-00). Eintritt 4 Euro, Familie 8 Euro. Bis 18. Mai. Di-Fr 9-18, Sa/So 10-18 Uhr. Internet: http://www.hnf.de/
______________________________________________________
AM RANDE:
Ein Gedankenspiel der Ausstellung betrifft das so genannte „Hilbert-Hotel”: Angenommen, ein Hotel hätte unendlich viele Zimmer, aber dann kämen auch unendlich viele Gäste. Wie kann man sie unterbringen? Wir verraten nur dies: Das Zauberwort heißt „Zimmerwechsel”.
An anderer Stelle können Besucher Stäbchen auf eine Fläche mit vorgezeichneten Linien werfen. Voraussage für die Summe aller denkbaren Zufallswürfe: Aus sämtlichen Schnittpunkten ergibt sich auf Dauer das Maß der Kreiszahl Pi. Verblüffend!