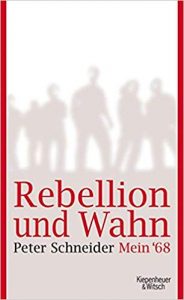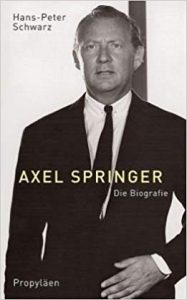Von Bernd Berke
Vierzig Jahre ist es nun schon her, doch das Thema scheint schier unerschöpflich: Was ist vom Mythos des rebellischen Jahres 1968 geblieben? Was wirkt weiter? Was hat sich womöglich „erledigt“? Mit solchen Fragen befassen sich in diesen Jahr etliche Buchautoren. Eine Auswahl:

Höchst provokant geht Götz Aly zu Werke, ein einstiger Mitstreiter der Revolte. Verglichen mit damals, vollzieht er eine komplette Kehrtwende. Schon der Titel seiner Abrechnung, „Unser Kampf 1968″, der gefährlich an Adolf Hitlers „Mein Kampf“ anklingt, lässt es ahnen. Zwar kann auch Aly bis heute die Anstöße zum Aufstand (verdrängte NS-Vergangenheit, Vietnamkrieg, Springer-Presse) nicht ganz leugnen, doch wendet er ansonsten alles gegen die studentischen Akteure.
Als wolle er sich und seine Generation nachträglich selbst bestrafen, bezeichnet Götz die Studentenrevolte als eine „Bewegung“, die manches mit den verhassten Vätern aus der NS-Zeit gemein gehabt hätte – bis hin zur Figur des Anführers, dem laut Aly „machthungrigen“ Rudi Dutschke.
Seine Quellen waren u. a. Akten vom Verfassungsschutz. Skepsis wäre da angebracht gewesen. Statt dessen: schnöder Verrat an der eigenen Jugendzeit! Wolfgang Kraushaar vom Hamburger Institut für Sozialforschung vertritt ähnliche Thesen, doch ungleich leiser. Sein mit Anmerkungen gespicktes Buch „Acht und Sechzig. Eine Bilanz“ kehrt totalitäre Versuchungen und Tendenzen der Revolte hervor, wie sie seinerzeit schon der Philosoph Theodor W. Adorno angeprangert hat.
Andere sagen’s gänzlich anders: Laut Peter Schneider war Rudi Dutschke ein Mensch „reinen Herzens“, und Reinhard Mohr attestiert dem Studentenführer schlichtweg mitreißendes Charisma. Der Schriftsteller Peter Schneider (Romanerfolg „Lenz“) hat für „Rebellion und Wahn – Mein 1968″ seine Tagebücher von damals neu gelesen – mit wachem Sinn für beide Lebensphasen. Er macht die Impulse seiner jungen Jahre nicht nieder, sondern nimmt sie wichtig, ohne sie zu glorifizieren. Ein betrüblicher Befund: Das Private sei in jenen Jahren unterm Politischen verschüttet worden. So bemerkt Schneider heute mit Erstaunen, dass er damals eine Liebesgeschichte durchlitten hat, die im Grunde mindestens so bedeutsam war wie all die Demos, in deren Sog man anfangs eher per Zufall hineingeraten sei.
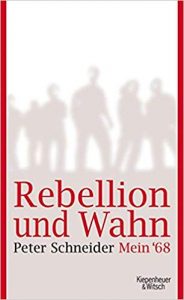
Reinhard Mohr („Spiegel online“) ist kein Achtundsechziger, sondern ein Nachgeborener. In „Der diskrete Charme der Rebellion“ betrachtet er die Dinge aus ironischer Distanz, was als Gestus des „Darüberstehens“ nicht immer angenehm ist. Recht ausführlich zeigt er die Vorgeschichte: Stumpf- und Biedersinn der Adenauer-Zeit; erste Gegenkräfte, etwa bei den Schwabinger Gaudi-Krawallen der frühen 60er Jahre.
Mohr schildert Konflikte zwischen dem strengen Studentenbund SDS und der „Spaßguerilla“ rund um die „Kommune 1″. Kommunarde Fritz Teufel, so erfahren wir, habe viele Groupies gehabt, während Dutschke verbissen die Klassiker las. Mohrs Fazit: Vieles sei neoromatische Halluzination gewesen, Selbstüberschätzung aus bloßen Stimmungen heraus – mit Ausläufern bis in die RAF-Terrorszene. Diese Schattenseiten vergisst kein Autor.
Rudolf Sievers verfolgt mit „1968 – Eine Enzyklopädie“ eine völlig andere Absicht. Mit Texten zum bewegten Jahr (Marx, Adorno, Marcuse, Enzensberger, Dutschke, Flugblätter usw.) will er den Zeitgeist von ’68 wieder lebendig machen. Manches liest sich mit Gewinn, doch man steigt nicht zweimal in den selben (Zeit)-Fluss.
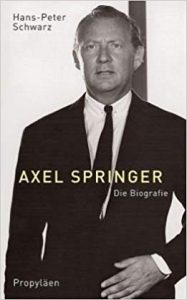
Hans-Peter Schwarz hat sich einer Hassfigur der „68er“ gewidmet: In „Axel Springer. Die Biografie“ lässt er dem Mann, dessen „Bild „-Zeitung die Stimmung gegen Dutschke und Genossen seinerzeit anheizte, größtmögliche Gerechtigkeit widerfahren. Es waltet Verständnis für die Motive des Großverlegers. Springer habe „Schneid“ besessen und sich nicht gängigen Meinungen anbequemt. Als nach dem Attentat auf Dutschke die „Bild“-Lieferwagen brannten, habe er freilich tief betroffen über einen (Teil)-Verkauf seines Imperiums nachgedacht.
Die Kulturgeschichte der 60er Jahre, die nachhaltiger gewirkt haben dürfte als alle politisierten Debatten, kommt leider in allen Bänden zu kurz. Auch wird die „Provinz“ kaum in den Blick genommen. Meist nur Berlin, Frankfurt und Paris – das ist nicht die ganze Wahrheit.
____________________________________________
SERVICE
Die vorgestellten Bücher
- Götz Aly: „Unser Kampf 1968″. S. Fischer Verlag. 256 Seiten, 19,90 Euro.
- Peter Schneider: „Rebellion und Wahn. Mein ’68“. Kiepenheuer & Witsch, 364 Seiten, 19,95 Euro.
- Wolfgang Kraushaar: „Acht und Sechzig. Eine Bilanz“. Propyläen. 256 S., 19,90 Euro.
- Reinhard Mohr: „Der diskrete Charme der Rebellion“. Wolf Jobst Siedler Verlag (wjs). 238 S., 19,90 Euro.
- Rudolf Sievers (Hrsg.): „1968. Eine Enzyklopädie“. Edition Suhrkamp. 475 Seiten, 18 Euro.
- Hans-Peter Schwarz: „Axel Springer. Die Biografie“. Propyläen. 600 S., 26 Euro.
- Außerdem zu nennen:
- Gerd Koenen / Andreas Veiel (Hrsg.): „1968. Bildspur eines Jahres“ (200 Pressefotos der Zeit). Fackelträger, 190 Seiten, 29,95 Euro.
- Lothar Menne: 1968. Unter dem Pflaster lagen die Träume“. Goldmann Verlag, 250 S., 14,95 Euro.
- Michael Ruetz: „1968. Die unbequeme Zeit.“ Steidl Verlag, 224 S., 40 Euro.
- Norbert Frei: „1968. Jugendrevolte und globaler Protest“. dtv premium, 288 S., 15 Euro.
______________________________________________
EXTRA
Generation ’68 im Revier
- In Paris gingen sie auf die Barrikaden – und in Berlin. Aber an Rhein undRuhr – gab es da auch die zornige Generation ’68?
- Der Autor Manuel Gogos beantwortet die Frage auf seiner Feature-CD „Die Revolution mit der Heizdecke“ (8,50 Euro) klar mit ja. In Bonn rauchten freche Studis die Zigarren des Rektors, in Köln rockte sich die Band CAN in Trance, selbst an den Werkstoren im Revier wurde erregt diskutiert. Was haben die Kinder der Revolution gewollt? Warum verflossen Pop und Protest?
- Als Studenten auf die Barrikaden gingen und Arbeiter mehr Rechte einforderten, war Norbert Kozicki gerade 15.
- Der Aufbruch faszinierte den heutigen Sozialwissenschaftler. Was den Pazifisten begeisterte: Die jungen Rebellen entdeckten ’68 eine neue, unblutige Waffe – die Sprache.
- Genau das ist Thema von Kozickis Buch „Aufbruch in NRW. 1968 und die Folgen“ (7,95 Euro).
- Beide Titel sind im Rahmen der „mediathek für Nordrhein-Westfalen“ ab sofort in den WR-Leserläden zu haben.