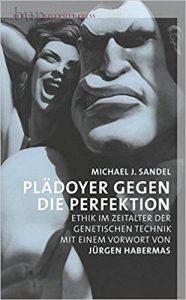Yoko Ono: Kunst ohne jeden Umweg
Bielefeld. Die meisten kennen Yoko Ono als Witwe des Ex-Beatles John Lennon. Dass sie selbst schon seit 1961 auf der Kunstszene agiert, gehört nicht zum Basiswissen. Doch nun richtet ihr Bielefelds Kunsthalle die größte Werkschau aus, die sie in Europa je gehabt hat.
Das heißt: „Werkschau” oder Retrospektive sind vielleicht keine passenden Begriffe, Yoko Ono lehnt sie jedenfalls ab. Nennen wir’s also eine Häufung der Ausdrucksformen – vom Film bis zur Zeichnung, vom Objekt bis zur bloßen Ideen-Notiz. Kunsthallen-Chef Thomas Kellein: „Sie ist eine Künstlerin, die keine Ruhe gibt. Sie will und kann nicht abschließend einsortiert werden.” Aber schauen wir mal, was sie so macht.
Leichenwagen und
Himmelsleitern
Bereits draußen vor der Kunsthalle legt die heute 75-Jährige ihre Spuren. Hier werden sich bald Onos „Himmelsleitern” recken, die einen Hang zum Höheren offenbaren. Stufe für Stufe. Schon jetzt gibt es dort „Wunschbäume”, an die man Zettel mit Hoffnungen heften kann. Und dann steht da noch ein veritabler Leichenwagen, mit dem sich Besucher durch die Stadt chauffieren lassen dürfen (15 Minuten für 5 Euro). Warum? Weil die Künstlerin es sich so vorgestellt hat.
Bei ihr regiert oft der blitzartige Einfall, der nach rascher Umsetzung, ja Entladung drängt. Da hat sie frühmorgens Sonnenstrahlen er-blickt – und kurzerhand entsteht eine Strahlenbündel-Skulptur, die diesen Moment einfangen soll. Da hat sie von Katzen mit glühenden Augen geträumt – und alsbald stehen da 54 derartige Tiere als Installation im Raum (siehe Bild). Diese Kunst will sofort und direkt „da” sein. Geradeaus, zuweilen ziemlich simpel.
Yoko Ono war freilich auch eine Pionierin der Konzeptkunst, die mehr von skizzenhaften Ideen als von genauer Ausführung lebt. So sieht man denn zahllose schriftliche „Anweisungen” an den Wänden. Etwa die, dass man im Konzerthaus geräuschlos Fahrrad fahren solle oder dass man so lange auf einem spartanischen Bett nächtigen möge, bis sich auf dem Laken ein „Gemälde” abzeichnet. Immerhin: Bett und Rad stehen als Objekte bereit; ganz so, als könne man jede Kopfgeburt flugs verwirklichen. Ansätze zur Bewusstseins-Erweiterung, zum Umdenken? Nicht immer. Manchmal franst diese Kunst an den Rändern in Wirrnis aus.
Dass wir alle zu hohen Prozentsätzen aus Wasser bestehen, ist bekannt. Bei Yoko Ono wird auch aus diesem Befund recht umstandslos die raumgreifende Installation „We’re all Water”. 118 mit Wasser gefüllte Gläser sind aufgereiht, jedes säuberlich mit einem bekannten Namen beschriftet. Die Skala reicht vom Dichter Rilke über John Lennon bis zu Adolf Hitler. Sollen wir denken, dass die schiere Wässrigkeit all diese Gestalten einander angleicht? Das wäre heikel.
Yoko Ono hat auch eine frauenbewegte Ader. Drei aufgeschüttete Erdhügel stehen für verschiedene Formen der Gewalt gegen Frauen oder besser: für deren offenbar immergleiche Folgen. Gegenstück ist der „Familienraum”. Ganz egal, ob Spiegel, Frauenschuhe, Haarbürste, Kleiderbügel, Esstisch oder Kästchen – aus allen Gegenständen quillt Kunstblut. Häusliche Gewalt, auf einen einfachen, plakativen Nenner gebracht.
Hie und da werden Besucher zum Mitmachen angestiftet. Auf anfangs leeren Leinwänden sollen sie Bilder ihrer Mütter anbringen. Einen zerteilten und in Boxen verpackten Silikon-Körper soll man berühren („Touch me”); am besten ganz weihevoll, nachdem man die Hand in Wasser getaucht hat. Daneben läuft ein 25-minütiges Video, in dem sich eine Fliege nach und nach auf alle Partien eines nackten Frauenleibes setzt. Auch die befreite Phantasie fliegt, wohin sie will.
Vor allem aber sollen wir alle stets ganz fest an Frieden denken. Yoko Ono glaubt, dass dies die Energien umpolt – bis eines Tages wirklich überall Frieden herrscht. Das klingt einfältig. Oder sollten wir’s vorsichtshalber doch mal probieren – vielleicht zum Sound von Lennons Gassenhauer „Give Peace a Chance”?
Kunsthalle Bielefeld (Artur-Ladebeck-Str. 5). Bis 16. Nov. Di, Do, Fr, So 11-18, Mi 11-21, Sa 10-18 Uhr. Eintritt 7 €
________________________________________
ZUR PERSON:
- Yoko Ono wird am 18. Februar 1933 in Tokio (Japan) geboren.
- 1952 wandert sie dauerhaft in die USA aus.
- 1956 erste Ehe mit einem Komponisten (bis 1962).
- 1961 erste Galerie-Schau.
- 1962 zweite Ehe mit einem US-Filmproduzenten.
- 1966 lernt sie den Beatle John Lennon kennen.
- 1969 Heirat mit Lennon auf Gibraltar. In den Flitterwochen das legendäre „Bed-In” (Ono und Lennon öffentlich im Bett) im Amsterdamer Hotel.
- Viele Beatles-Fans machen bis heute Yoko Ono fürs Ende der Gruppe (1970) verantwortlich.
- Ono und Lennon produzierten mit der Plastic Ono Band Songs wie „Give Peace a Chance”, „Cold Turkey” und „Mother”.
- 1980 (8. Dezember): John Lennon in New York erschossen.