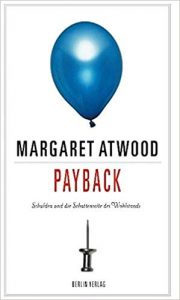Wo sich Jutta auf Kalkutta reimt
Wie soll man das Phänomen bloß jüngeren Leuten erklären? Willy Millowitsch, so könnte man (hilflos) anheben, war ein kölsches Naturereignis, ein Vulkan des Frohsinns. Wenn dieser urwüchsige, eruptive Mann die Bühne betrat, johlten viele Leute schon, bevor er auch nur ein Wörtchen gesagt hatte.
Dieser volkstümliche Schauspieler, am 8. Januar 1909 (also vor 100 Jahren und natürlich in Köln) geboren, konnte dem Affen Zucker geben wie kaum ein Zweiter. Doch ihm standen auch leisere Töne zu Gebote.
Mal ehrlich: Wer gegen Ende der 60er und in den frühen 70er Jahren jung gewesen ist, für den waren Gestalten wie Willy Millowitsch, Inge Meysel & Co. erschröckliche Anti-Figuren, Repräsentanten einer schwer erträglichen „Leitkultur” des Spießertums. Millowitsch-Gassenhauer wie „Schnaps, das war sein letztes Wort” oder „Wir sind alle kleine Sünderlein” waren keine Hits, die man als Rockfan wirklich hören wollte.
Über Jahrzehnte kannte man Willy Millowitsch als Garanten entfesselter Lustigkeit. Schon manche Titel des Klamauk-Kinos und Schenkelklopf-Theaters („Paradies der flotten Sünder”, „Tante Jutta aus Kalkutta”) lassen es ahnen: Angesagt waren polternde, gern etwas schlüpfrige Verwechslungskomödien.
Doch später wurde man nicht nur milder im Urteil, sondern entdeckte tatsächliche Qualitäten. Stutzig musste man spätestens werden, als der hellwache und wendige Autor Hans Magnus Enzensberger seine Molière-Neuübertragung „Der Bürger als Edelmann” eigens auf den von ihm hoch geschätzten Millowitsch zuschnitt. Es wirkte wie ein Signal zur Umkehr: Jürgen Flimm verfilmte Else Lasker-Schülers Drama „Die Wupper” mit Millowitsch, der Regisseur Rudolf Noelte ließ ihn den Totengräber in Shakespeares „Hamlet” spielen. Auch der gereifte Kommissar Klefisch, den Millowitsch ab 1990 im WDR-Fernsehen verkörperte, zeigte ungeahnte Charaktertiefe.
Er hatte weder Schulabschluss noch Schauspielausbildung, als er 1940 die Leitung des (1896 vom Großvater gegründeten) Kölner Familientheaters übernahm, das heute von Sohn Peter fortgeführt wird. Der damals dort gepflegte, deftig harmlose Humor eignete sich zur Ablenkung vom Krieg, also wurde die Bühne zur Truppenbetreuung zwangsverpflichtet.
Kölns damaliger OB Konrad Adenauer sorgte dafür, dass sich schon im Oktober 1945 erneut der Vorhang hob – „damit die Leute wieder wat zu Lachen haben.” Der große Erfolg kam mit dem Fernsehen. Im Oktober 1953 war der Militär-Schwank „Der Etappenhase” mit Millowitsch der erste live gesendete Theaterabend der deutschen TV-Geschichte. Zwar gab’s seinerzeit bundesweit nur etwa 10 000 Fernsehapparate, doch es folgten ja noch über 100 weitere Stücke. Besagter Kracher um „Tante Jutta” hatte 1962 eine sagenhafte Zuschauerquote von 88 Prozent.
Ein Erfolgsgeheimnis ist wohl die „Erdung”, sprich: lokale Verwurzelung in Kölle. Millowitsch wurde vor seinem Tod (20. September 1999) Ehrenbürger, sein Denkmal steht dort – und bis heute pilgern Menschen ans Grab auf dem Melaten-Friedhof. Zu seinen besten Zeiten galt am Rhein: Allenfalls der Dom, der Karneval und der 1. FC Köln waren ähnlich wichtig.