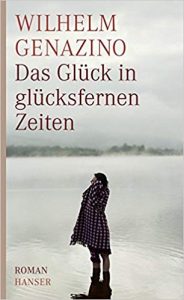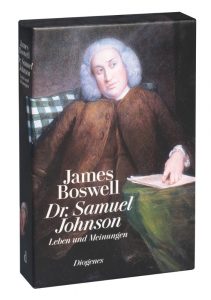Thomas Bernhard: Er hasste die Preisreden – und nahm das Geld
Literaturpreise sind doch eine wunderbare Sache, sie bedeuten etwas Ruhm und Geld für den Autor, der sonst vielleicht arm und unbeachtet geblieben wäre.
Solche milden Gaben können aber auch Zorn erregen. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, so ist er hier zu finden: Aus dem Nachlass von Thomas Bernhard ist jetzt der schmale, aber ergiebige Band „Meine Preise“ erschienen, in dem der unbequeme Österreicher einige seiner Auszeichnungen durch den Wolf dreht. Klingt schon mal vielversprechend, denn Bernhard war als schimpfwütiger Rohrspatz der Literatur ohnehin kaum zu übertreffen.
Gelegentlich grinst einen hier das ganze absurde Elend des Literaturbetriebs zwischen Streichquartetten und blödsinnigen Festreden an. Ein bilanzierendes Bernhard-Zitat lässt den ewigen Zwiespalt ahnen: „Ich haßte die Zeremonien, aber ich machte sie mit, ich haßte die Preisgeber, aber ich nahm ihre Geldsummen an.” Welch eine lästige, stocksteife Notwendigkeit also. Hinfahren, abholen und alles andere vergessen. Das wäre wohl ratsam.
So kennt man ihn: Thomas Bernhard ist zutiefst beleidigt, wenn er einen Preis n i c h t kriegt – und er ist oft stinksauer, wenn er dann einen bekommt. Eigentlich kein Wunder. Denn tatsächlich kann er hanebüchene Szenen schildern: Da wird er von einem ahnungslosen Laudator mit der gleichzeitig geehrten Preisträgerin verwechselt („Frau Bernhard”), auch hernach wird der Schlendrian nicht korrigiert. Oder: Der Autor, der mal wieder in Begleitung seiner Tante erschienen ist, wird von der versammelten Festgemeinde im Saale gleich gänzlich übersehen und irgendwo hinten in Reihe soundsoviel platziert. Man kennt den Dichter überhaupt nicht, mit dem man sich schmückt.
Thomas Bernhard rächt sich nicht zuletzt damit, dass er ganze Städte (wie etwa Bremen) wortgewaltig als kulturlose Orte niedermacht. Man ahnt es: Derlei süffige Stadtbeschimpfungen aus berufenen Federn wären gewiss mal eine Extra-Edition wert.
Als schiere, mit voller Absicht betriebene Demütigung empfindet es Bernhard, dass man es wagt, ihm den kleinen (und eben nicht den großen) Österreichischen Staatspreis anzudienen. Diese mindere Ausführung trage doch fast jeder Nachwuchsschreiberling mit sich herum, befindet der Mann, der sich selbst zeitweiligen Größenwahn attestiert.
Als es den Schriftsteller selbst einmal in eine Jury verschlägt, merkt er, wie man dort „naturgemäß” (Bernhards Lieblingswort) nach kenntnisfreier Willkür, Lust und Laune entscheidet. „Nehmen wir doch Hildesheimer”, ruft da einer unvermittelt in die Runde. Alle anderen sind gleich einverstanden, denn das Mittagessen wartet ja schon.
Bernhard windet auch einige bunte Girlanden in seine Betrachtungen. So erfährt man, wie er sich von einem Preisgeld einen schicken Sportwagen gekauft und alsbald zu Schrott gefahren hat oder wie er ein marodes Haus anzahlen konnte.
Der Autor, der sich sonst (wie auch seine Preis-Dankesreden im Anhang belegen) vor allem auf pessimistische Litaneien verstand, wird hier sichtbar als jemand, dem es auch gegeben war, luftig leicht zu erzählen, ohne dabei an Schärfe zu verlieren.
Thomas Bernhard: „Meine Preise”. Suhrkamp. 144 Seiten. 15,80 Euro.