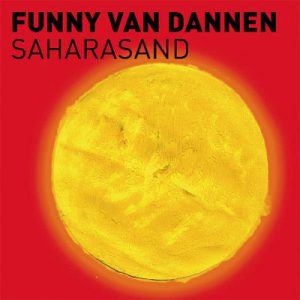Bloß keine Posen mehr
Dieser böse Blick fürs Beschädigte, fürs stets und dauerhaft Misslingende! Welch ein illusionsloses Buch, wie misanthropisch und pessimistisch das alles klingt. So sicher scheint sich die namenlose Ich-Erzählerin ihrer Weltverachtung zu sein, dass ihre Tiraden manchmal geradezu in einen Kolumnen-Plauderton verfallen. Ganz so, als müsse sie sich nur noch aus einem fertigen Fundus bedienen, um unentwegt den heillosen Nachteil des Geborenseins zu beklagen.
Die finstere Inventur klingt dann beispielsweise so: „Die Menschen hatten ihre niedlichen Momente, doch das täuschte nicht darüber hinweg, dass die meisten von überwältigender Einfalt und Niedertracht waren (…) Jeder fühlte sich dem anderen überlegen, und daraus bildete sich ein Dauerton der Aggression (…)“
Ja, zum Teufel, worum geht es denn überhaupt? Um Sibylle Bergs neuen Roman „Der Mann schläft“. Darin passiert – rein äußerlich besehen – nicht viel: Besagte, ein wenig in die Jahre gekommene Erzählerin hat nach langen, hie und da freudlos promisken Single-Zeiten und all ihren individuellen wie kollektiven Selbsttäuschungen, irgendwann d o c h den einen Mann kennen gelernt, bei dem sie sich zutiefst und ganz selbstverständlich geborgen fühlt. Als sie aber auf eine chinesische Insel vor Hongkong verreisen, verschwindet dieser Mann spurlos. Ob aus Untreue oder durch ein Unglück, das bleibt offen.
Die Frau ist jedenfalls untröstlich – vielleicht für alle verbleibenden Jahre. Oder wird sie sich trotz allem in ein anderes Leben schicken, in dem wenigstens andere (ein kleines Mädchen und dessen Großvater) an ihr Halt finden können? Auch das bleibt in der Schwebe. Doch scheinen am Ende die allergrößten Gefahren gebannt.
Pflegt man markante Passagen anzustreichen, so könnten die Seiten dieses Buches nach der Lektüre sehr „bleihaltig“ aussehen. Häufig möchte man ja Wort für Wort beipflichten, so ausgefeilt liest sich das, so aphorismentauglich gedrechselt. Gekonnt und gewitzt wird mit dem Klischee-Vorrat gespielt. Beispiel:
„Wir wirken wie zwei Figuren aus einem existenzialistischen Film, der sechs Stunden dauert und in dem kaum gesprochen wird, in minutenlangen Sequenzen rinnt Wasser an Scheiben hinunter, und ein nasser Hund eiert am Horizont entlang.“ Genau! Den Film kennen wir alle.
Hinterrücks beschleicht einen trotz aller Beschreibungskunst zuweilen ein gewisses Misstrauen: Kommt diese Suada, diese stellenweise schon pittoreske Verzweiflung übers schlimme Leben nicht manchmal allzu geläufig und meinungsförmig daher statt einfach nur zu schildern, was geschieht? Man könnte oft absatzweise zitieren. Aber müsste Literatur auf dieser Anspruchshöhe (im hochmögenden Umfeld des Hanser-Verlagsprogrammes) nicht sperriger sein, sich nicht entschiedener einem gar zu süffigen Konsum entziehen? Nun ja, wenn man’s denn gern puristisch und puritanisch hätte…
Die Ich-Figur will sich dem großen Ganzen verweigern, sie entwirft eine „Philosophie“ der selbstgenügsamen Langsamkeit und des somnambulen Rückzugs – am besten ins eigene Kämmerlein und dort am besten ins Bett, wo man still liegen bleibt und einander möglichst schweigend umarmt. Das lässt sich auch lesen als Absage an Ideen und Gefühle im Gefolge von „1968“ mit seinem Drang nach individueller Freiheit, Autonomie und Emanzipation.
Stattdessen: Eskapismus, wenn man so will. Aber bitte paarweise, wenn’s denn geht. Tenor: Bloß keine weiteren Ansprüche mehr ans Leben stellen, die werden ohnehin nicht erfüllt. Sich gegen alle Zudringlichkeiten wehren. Nur in einer solchen Haltung kann man die (dieser Lesart zufolge) furchtbar viele restliche Zeit halbwegs kommod hinbringen, die einem auf Erden gegeben ist. Man könnte das als furchtbar spießig missverstehen, als Rückkehr in alte, überwunden geglaubte Zweisamkeiten. Aber was heißt heute schon „spießig“, derlei einstige Streitbegriffe zählen kaum noch.
Die jederzeit mögliche Katastrophe blitzt immer wieder zwischen den Zeilen auf, so etwa in Visionen von abgetrennten Köpfen oder Gasmasken-Gesichtern. Auffallend überdies, wie der Erzählerin Menschen begegnen, die sonst in öder Normalität eines Immer-so-weiter-Machens ersticken und aus denen urplötzlich ganze Lebensgeschichten herausquellen, überaus reflektiert und druckreif formuliert – wie immer schon bereit liegend. Sie sprechen wie klügere Schattenbilder ihrer selbst. Oder sind es schon Geisterstimmen aus dem Jenseits, dem Totenreich?
Was bliebe zu tun? Nun, eher soll man das meiste bleiben lassen, wenn man eine Moral aus all dem zerren will. Der Mensch dürfte sich generell nicht mehr so wichtig nehmen, er sollte möglichst nicht einmal verreisen (was will er denn in der unbegreiflichen Fremde?), also auch außerhalb seiner engeren Sphäre kein Aufhebens von sich machen. Sich und anderen nichts mehr vormachen. Zitat:
„Irgendwann wollen sie doch alle nur nach Hause, egal, wie glänzend der Beruf ist, egal, wie obsessiv die Party war, sie wollen irgendwohin, wo sie die Schuhe ausziehen können (…) Wenn sie sich nur damit begnügen wollten, die Idioten, wenn sie nur nicht selbstgerecht durchs Leben jagen wollten (…)“ Endlich Ruhe…
Lebensläufe ganzer westlicher Mittelschichts-Generationen werden hier so gehörig eingedampft: „Als sie den Eltern entwachsen waren, hatten sie vielleicht kurz mit Millionen anderer den Aufstand geprobt, sich als Punker verkleidet oder Atomkraftgegner, um sich dann schnell einzuordnen in die Pullunder- und Halbschuhwelt, in der man eine Ausbildung macht, heiratet, zwei Kinder erzeugt und anschließend leise die Welt verlässt, ohne irgendeine noch so minimale Störung auf ihr hinterlassen zu haben.“ Kommt gut, nicht wahr? Die von allem Unwesentlichen entschlackte, bitterlich angespitzte Erkenntnis, dass alle Rebellion nur Pose war. Es könnte glatte eine Comedy-Vorlage sein.
Wie heute oft üblich, wird einem keine anstrengende Lesestrecke zugemutet. Sibylle Berg (Jahrgang 1962) erzählt nicht in einem langen epischen Atemzug, sondern gliedert den Stoff in ganz kurze Kapitel, die im unstet raschen Wechsel jeweils „damals“ und „heute“ spielen. „Damals“ heißt vor und während der Beziehung mit dem hernach verschollenen Mann. „Heute“ taumelt gleichsam nur noch unglückstrunken von Augenblick zu Augenblick und vergegenwärtigt das bestürzende Alleinsein der Frau am exotischen Rand Chinas.
Nicht nur am fernen Horizont sieht man hinter all dem die zerstörerischen Kräfte schrankenlos gierigen Wirtschaftens wüten – vornehmlich in Hongkong und bei einem Abstecher nach Tokio. Es sind Kräfte, die bewirken, dass der Mensch sich völlig abhanden kommt. Nicht nur ein einziger Mann wird verschollen sein…
Sibylle Berg: „Der Mann schläft“. Roman. Hanser Verlag, 309 Seiten, 19,90 €.
_________________________________________________________
Die Autorin (Homepage: http://www.sibylleberg.ch) liest einige Abschnitte aus dem besprochenen Buch. Link:
http://www.hanser-literaturverlage.de/extras/videos/sibylle-berg-liest-aus-der-mann-schlaeft.html
oder