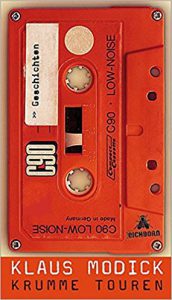Wer sich an Dekadenz berauscht
Der Schriftsteller Gerhard Henschel, der sonst schon mal ausgiebig in persönlich gefärbten Erinnerungen schwelgt („Kindheitsroman“, „Jugendroman“), hat sich diesmal auf anderes Terrain begeben. Dabei geht er abermals aufs Ganze: Sein neues opus magnum heißt „Menetekel“, ist so fußnotenreich wie eine veritable Doktorarbeit und verhandelt laut Untertitel nicht weniger als „3000 Jahre Untergang des Abendlandes“.
Mit Hunderten und Aberhunderten von markanten bis monströsen Zitatstellen führt der fleißige Sammler Henschel vor, dass es in allen, aber auch wirklich allen Epochen Kulturpessimisten und Apokalyptiker der finsteren Sorte gegeben hat. Mit sozusagen erektil anschwellender Phantasie, die selten von eigener Erfahrung gesättigt war (erst recht nicht von lustvoller), malten sie den bevorstehenden Untergang in grellsten Farben aus; vorzugsweise, indem sie den angeblichen Verfall der sexuellen Sitten in möglichst drastischer Behauptungs-Prosa schilderten.
Die gestrengen Beobachter gaben sich gern den Anschein, als hätten sie höchstselbst jeden Vorhang gelüftet, um ihn sodann mit ergötzlichem Ekel zuzuziehen. Nicht nur Henschels virulenter Verdacht: Sie geilten sich an den Objekten der eigenen Empörung auf, vielleicht gar insgeheim mit onanistischen Absichten. Oft genug aber auch mit kriegerischen.
Auf der Suche nach dem vermeintlich goldenen Zeitalter, das sie alle als heilsamen Kontrast beschworen haben, begibt sich Henschel historisch immer weiter zurück. Geradezu komischer Effekt dieser „Früher-war-alles-besser“-Retrospektive: In der jeweils vorherigen, angeblich noch so idyllischen und sittsamen Ära finden sich stets sehr ähnliche Klagen über Dekadenz. Und so weiter und so fort – zurück bis zum Anbeginn der schriftlich überlieferten geschichtlichen Zeit…
Auf Dauer gerät der Chor all der erzkonservativen Mahner ein wenig monoton, denn die Grundmuster ihrer jammervollen Klagen sind einander ziemlich ähnlich. Davon lässt sich Henschel leider anstecken, indem er all diese ausführlichst zitierten Positionen hernach mit der immergleichen, triefenden Ironie kurz und knapp abwatscht. Genauere Analyse überflüssig. Tenor: Diese Leute waren sexuell frustriert, haben auch anderen Menschen keine Lebens- und Liebesfreude gegönnt und sich just daher die tollsten, wüstesten Orgien ausgemalt, um sie den verhassten Feinden (Franzosen, Slawen, Juden etc.) zuzuordnen, sie mit (meist rechtslastigem) Furor zu verdammen und im Extremfall zur Ausmerzung aufzurufen.
Nicht immer treffen Henschels knappe Bemerkungen exakt den Kern der Verhältnisse. Zuweilen reicht ihm ein satirisches Zitat, um höhere Wahrheit wider die aufgetürmte Dummheit leuchten zu lassen, doch diese simple Methode verfängt nicht in jedem Falle. Auch verwirft Henschel jederlei Kritik an der permissiven Gesellschaft kurzerhand als lustfeindlich. So einfach ist das denn doch nicht.
Aufschlussreich herausgearbeitet sind hingegen häufig wiederkehrende „Argumentations“-Figuren wie das perfide Ausspielen einer deutschen/germanischen „Kultur“ gegen die niedere „Zivilisation“ vornehmlich der sündigen Franzosen. Hier erlaubt schon die schiere Fülle der Zitate manchen erhellenden Quervergleich. Aus ungeahnt aktuellen Gründen ist es auch verdienstvoll, dass Henschel das geläufige Gerede von der „spätrömischen Dekadenz“ stark relativiert. Von Guido Westerwelles ahistorischem Gefasel konnte er beim Verfassen des Textes noch nichts ahnen.
Die 14 Kapitel des Buches sind freilich von schwankender Qualität. Die übelsten „Franzosenfresser“, Antisemiten und Faschisten werden in den Orkus gestoßen, in den sie gehören. Doch das gleiche Schicksal ereilt auch einen Säulenheiligen der Linksliberalen, nämlich Günter Anders („Die Antiquiertheit des Menschen“). Er erscheint hier als unerträglich eitler Fatzke und haltloser Alarmist. So gerät er unversehens in eine Reihe mit Gestalten wie dem Ultra-Nationalisten und Schriftsteller Ernst Moritz Arndt (nach dem viele deutsche Straßen benannt sind) oder Oswald Spengler, von mörderischen NS-Ideologen ganz zu schweigen.
Behutsame historische Differenzierung scheint also nicht Henschels hauptsächliche Stärke zu sein. So könnte man argwöhnen – bis man die letzten Kapitel liest. Da geht es auf einmal schillernd, zwiespältig und widersprüchlich zu, also ungleich spannender als vordem, wo die Fronten überaus klar zu sein schienen. Das Kapitel über den Berserker-Poeten Rolf Dieter Brinkmann („Keiner weiß mehr“, „Westwärts 1 & 2“) führt einen wahrhaft sprachmächtigen Daseinshasser vor Augen, der sich um und nach 1968 zu monströsen Wutschreien auf alles und jeden verstiegen hat. Beim Rom-Aufenthalt etwa bespie er die Italiener verbal als „Spaghettifresser“ und „Sackkratzer“.
Schließlich betritt mit dem ebenso famosen Schriftsteller Ror Wolf ein Mann die Weltbühne, der seinerseits die schwärzesten Katastrophen kommen sieht, solche Befürchtungen aber zu Grotesken ballt. So gibt es also doch Warnungen, auf die man haarfein hören sollte!
Gerhard Henschel: „Menetekel – 3000 Jahre Untergang des Abendlandes“. Eichborn Verlag (Reihe „Die andere Bibliothek“), Frankfurt. 372 Seiten. 32 Euro.