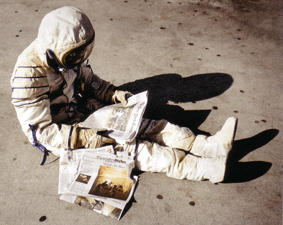Essener Philharmonie: Hoffnung auf Glücksgefühle
Als im Juni 2004 der alte Essener Saalbau, entkernt und als Philharmonie zu neuem Glanz gekommen, seine Pforten wieder öffnete, versprach Gründungsintendant Michael Kaufmann “reihenweise Glücksgefühle”. Da sollte der Zauber des Anfangs möglichst lange halten, doch der forsche, selbstbewusste, für die Musik brennende Kaufmann musste schon 2008 seinen Hut nehmen. Wegen Überziehung des Etats, wie es offiziell hieß.
Seitdem ist Johannes Bultmann der Chef des Hauses, in seiner Ruhe gediegen, wie ein emotionsloser Verwalter eines Kunstbetriebes wirkend. Gleichwohl verbirgt sich hinter dieser Zurücknahme unbedingtes Engagement. Mit Bultmann mag eine Art neue Sachlichkeit in die Philharmonie eingezogen sein, doch das Ziel, einem breiten Publikum vielfältige Klangwelten zu erschließen, ist ihm gewichtiges Anliegen.
Jetzt hat Bultmann das Programm der Saison 2011/12 vorgestellt – dabei mit den Worten Sensation oder Star äußerst sparsam umgehend. Überhaupt leitet er Konkretes vom Allgemeinen ab, spricht zunächst von der Motivation des Philharmonie-Teams, von einigen Grundprinzipien, was die Auswahl der Künstler angeht. Sätze wie “Wir legen Wert auf Qualität”, oder “Wir wollen Interpretation statt mechanisches Abspulen von Musik” klingen ein wenig nach Allgemeinplatz. Doch dann wendet sich der Analytiker unter den Intendanten dem Publikum zu, redet über Kommunikation, Dialog und Partizipation.
Hehre Worte, die indes in Verbindung mit konkreten Beispielen greifbare Bedeutung gewinnen. Da sei etwa die Residenz von Sol Gabetta genannt: Die argentinische Cellistin wird nicht nur vier Konzerte geben, sondern auch zwei Meisterklassen an der Essener Folkwang Universität. Oder nehmen wir den Neue-Musik-Schwerpunkt “Now!”, der die amerikanischen Minimalisten Steve Reich und John Adams, den Aleatoriker John Cage sowie Frank Zappa vorstellt. Hier soll das Publikum an einem Abend selbst zum Komponisten werden.
Bultmanns Anliegen ist, mit neuen Formaten den starren Konzertbetrieb ebenso aufzubrechen wie unsere Hörgewohnheiten. So wollen sich das Kuss Quartett und das Stadler Quartett auf einen Dialog einlassen, indem sie beide dieselben Werke (von Mozart und Beethoven) spielen und über ihre musikalischen Vorstellungen sprechen – ein Interpretationsvergleich auf offener Bühne.
Bald wird klar: Bultmann meint längst nicht mehr ausschließlich Kinder und Jugendliche, wenn er zum Thema Education spricht. Natürlich werde weiterhin mit Schülern gearbeitet. Doch ebenso gebe es eine Kooperation mit der Universität Duisburg/Essen. Und genauso intensiv will der Intendant den Blick auf die Erwachsenen richten. Mit Werkeinführungen, die die Interpreten selbst im großen Saal der Philharmonie anbieten, oder mit Künstlerbegegnungen.
Das summiert sich über die Saison auf etwa 110 Konzerte. Themenreihen widmen sich den Komponisten Franz Schubert und Gustav Mahler, dem Lied, der Alten Musik, dem hoffnungsvollen Interpreten-Nachwuchs. Den Knaller aber, um es ein wenig salopp auszudrücken, präsentiert Bultmann beinahe zuletzt: Zur Saison-Eröffnung am 6. September wird Christian Thielemann mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden Anton Bruckners monumentale 8. Sinfonie aufführen.
Der Dirigent ist nur ein Beispiel im Reigen bedeutender, ja berühmter Interpreten, deren Aufzählung hier Seiten füllen würde. Wir dürfen sie mit Spannung erwarten und hoffen, dass sich beim Hören auch das eine oder andere Glücksgefühl einstellt.
Detaillierte Einblicke ins neue Programm gibt es unter www.philharmonie-essen.de