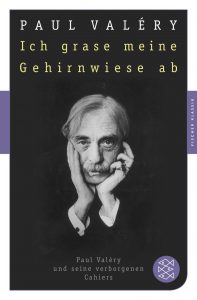Paul Valéry: Das Denken am frühen Morgen
Es war ein ungeheures Unterfangen: Rund 50 Jahre lang (1895-1945) ist der französische Schriftsteller Paul Valéry in aller Heidenfrühe aufgestanden, um „geistige Gymnastik“ zu betreiben, wie er es nannte. Hätte er jeweils abendliche Bilanzen gezogen, so wäre sein Denken wahrscheinlich in andere Richtungen gegangen. In den Stunden zwischen Tau und Tag also sind jene zahlreichen „Cahiers“ („Hefte“) entstanden, insgesamt ein zerklüftetes, schluchtenreiches Textgebirge, eines der großen Zeugnisse menschlicher Denkanstrengungen. Vieles klingt noch heute so frisch wie ein neuer Morgen.
Valéry meidet es nach Kräften, auf ausgetretenen philosophischen Pfaden zu wandeln, jedes System ist ihm zuwider. „Die meisten Fragen der Philosophie scheinen mir nicht meine zu sein, abseitig und sogar bedeutungslos, – bar jeder Notwendigkeit…“ Auch verachtet er bloße Lektüren ohne Erfahrung und beflissene Gelehrsamkeit, die das Wissen bestenfalls häuft und sortiert, aber nicht umgräbt.
Hier ist ein originärer Selbstdenker am Werk, der die Frage, was der Mensch überhaupt tun und wissen könne, noch einmal von Grund auf angehen will. Leitlinien sind eine geradezu mathematisch anmutende Strenge, die alles Unbewiesene und Verwaschene verwirft, sowie ein waches Misstrauen gegen Verfälschungen durch Sprache und deren vorgeprägte Muster. Zugleich ist hier ein universell entflammbares, schweifendes Denken umtriebig unterwegs, das seine Gegenstände augenblicklich ergreift.
In der verdienstvollen „Anderen Bibliothek“ des Eichborn-Verlags ist jetzt unter dem Titel „Ich grase meine Gehirnwiese ab“ eine Auswahl aus den „Cahiers“ erschienen, die unter Schlagworten wie „Ich“, „Sprache“, „Denken“, „Wahrnehmung“, „Leibliches Denken“, „Selbstsorge“ oder „Skepsis“ einige Schneisen durchs Dickicht schlägt. Die Edition soll hinführen zu umfassenderen Ausgaben, die freilich auch von Vollständigkeit weit entfernt sind.
Valérys Aussagen wirken stets luftig und kristallin klar. Vielfach verdichten sich seine Erkenntnisse zu trefflichen Maximen, die zwar historisch, jedoch keineswegs gestrig sind. Man möchte Satz um Satz zitieren. Das spricht auch für die Übersetzung. Dringlich gewünscht hätte man sich allerdings die Datierung und somit historische Erdung der Aufzeichnungen. So schweben sie vielfach im luftleeren Raum.
Rupfen wir nur einige wenige Halme aus der „Gehirnwiese“:
Der Mensch wird bestürzend sichtbar als biologische Maschine unter dünnem Zivilisations-Anstrich. Seine Identität ist nur ein Phantom, obwohl er mehr oder weniger bestrebt ist, sein Ureigenes zu sammeln. Zitat: „Man glaubt, man sei derselbe. Es gibt keinen Selben.“ Alles bleibt fragmentarisch und zufällig, nichts mag sich runden und vollenden. Selbst die wildeste Leidenschaft ist brüchig: „Mitten durchs rasende Toben geht ein Strahl von Ist-mir doch-egal.“
Aber lässt sich nicht doch ein Kernbestand festhalten? „Was bewahrt sich durch alle Zustände? Was erhält sich im Schlaf, im Traum, in der Trunkenheit, im Entsetzen, dem Liebestaumel? Dem Irrsinn?“
Wo also soll der Gedanke sein Gravitationszentrum finden? Valéry macht den menschlichen Körper als Angelpunkt und Grenze allen Denkens aus. Pure Gegenwart und Schmerz begleiten uns von Kind auf, körperliche Impulse und Versuchungen, Reize und Reaktionen steuern alles Sinnen und Trachten. Wen überrascht es, dass Valéry auch sexuelle Energieströme als Triebkräfte ansieht, die den Geist bewegen?
Stets muss man laut Valéry mit der prinzipiellen Begrenztheit der Gattung rechnen: Der Mensch nimmt nur einen Bruchteil dessen wahr, was insgesamt vorgeht. Auch sieht er nicht die Dinge selbst, sondern taucht alles ins flackernde Licht seiner Erwartungen. So erblickt er beispielsweise keinen Baum, sondern lediglich Farbflecken, die dann erst im Kopf zum Begriff „Baum“ montiert werden. Die Malerei jener Zeit hat solche Gedanken reichlich „bebildert“.
Valéry versteht tief greifende Selbsterkenntnis als notwendige Basis des Denkens. Wort für Wort durchwandere er sich selbst auf der Suche nach (seiner) Wahrhaftigkeit. Nicht „Ich denke, also bin ich“, sondern „Ich bin, also denke ich“. Sein eherner Vorsatz klingt nahezu naiv, hat es aber in sich: „Die Aufgabe: – nicht mehr mit dem denken, was wir als falsch erkannt haben. Mit dem denken, was uns klar geworden ist.“ Wer sich ein halbes Jahrhundert lang um die Schärfung des Instrumentariums bemüht, der darf, ja der muss so sprechen.
Paul Valéry: „Ich grase meine Gehirnwiese ab“. Die Andere Bibliothek (Eichborn), 348 Seiten, 32 Euro.