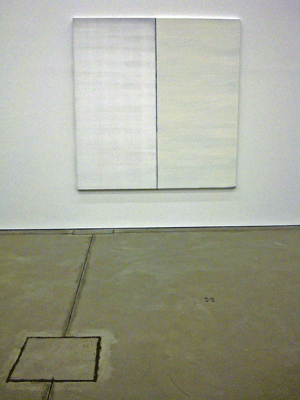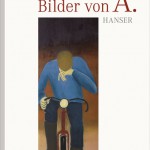Gibt es in der Literaturgeschichte ein größeres Prosawerk? Rund 150.000 Seiten sind es inzwischen (wobei die zweispaltig gedruckte Perry-Rhodan-Seite redliche 4.320 Zeichen enthält – ca. dreimal so viel wie die Standardseiten der meisten Buchverlage). Der Roman, der längst schon gigantische Dimensionen angenommen hat, wächst wöchentlich weiter.
Doch nicht allein in seinem Umfang sticht das Werk aus allem Bekannten hervor. Die erzählte Zeit der Perry-Rhodan-Heftserie reicht vom Jahr 1971 unserer vertrauten Zeitrechnung bis „gegenwärtig“ ins Jahr 1469 NGZ. Die Abkürzung steht für die Neue Galaktische Zeitrechnung, die im Jahr 3588 beginnen wird, weil nicht alle Völker des vereinten Galaktikums mit „Christus“ etwas anfangen können. Mehr als dreitausend Jahre an der Seite Perry Rhodans konnte der treue Leser seit 1961 live mitverfolgen. Hinzu kommen Zeitreisen bis ins Jahr 20.059.813 v. Chr. Da kann keine episch noch so breit angelegte Familiensaga des 19. oder 20. Jahrhunderts mithalten.
Und die Handlungsschauplätze? Die Milchstraße, ferne Galaxien, das versteht sich in einer SF-Serie von selbst. Daneben aber geraten die Kosmonauten immer wieder in Paralleluniversen im Sinne der Viele-Welten-Interpretation. Also auch als Weltroman dürfte Perry Rhodan kaum zu überbieten sein. Tausende verschiedener Völker sind mit ihren physiologischen, sprachlichen und kulturellen Besonderheiten zum Teil sehr phantasievoll beschrieben.
Die Romanfiguren? Neben dem relativ unsterblichen Perry Rhodan und seinen im Lauf der dreitausend Jahre leider nicht immer unsterblichen Frauen taucht in der Heftserie durchgängig ein Arsenal nicht nur terranischer Hauptpersonen auf, wie Atlan, Gucky, Icho Tolot, Alaska Saedelaere, Reginald Bull (um nur wenige zu nennen). Aber auch von den zahlreichen Nebenfiguren (11.199 Personen insgesamt listet derzeit die Internet-Enzyklopädie „Perrypedia“ auf) werden in einzelnen Heften immer wieder einige zu Protagonisten erhoben.
Wie bescheiden im Vergleich zu Perry Rhodan nimmt sich dagegen Balzacs Projekt aus, in 137 Romanen und Erzählungen seiner Comédie humaine (von denen der Balzac 91 fertigstellen konnte), ein Gesamtbild der Gesellschaft im Frankreich seiner Zeit zu entwerfen. Aber Balzac arbeitete allein. An den bis heute 2.612 Heften der Perry Rhodan-Hauptreihe, die am 8. September 2011 ihren 50. Geburtstag feiert, haben mehr als vierzig Autoren geschrieben (Nebenreihen wie „Atlan“ oder „PR-Action“ sowie PR- und Atlan-Taschenbücher mitgerechnet, sind es mehr als siebzig).
Im Unterschied zu anderen Heftserien wie Jerry Cotton oder Geisterjäger John Sinclair handelt es sich bei Perry Rhodan nicht um eine Reihung isolierter Abenteuer, die der Held zu bestehen hat, sondern um eine seit nunmehr fünfzig Jahren kontinuierlich fortgeschriebene Handlung, wenn auch mit verschiedenen Handlungssträngen. Ein solches Großunternehmen kann es sich gut und gern erlauben, die Hauptfigur auch mal über fünf Wochen (300 Seiten) aus den Augen zu verlieren oder nur beiläufig daran zu

Perry-Rhodan Clubausweis von 1968
erinnern, dass wir Perry Rhodan lesen; in dem Stil: Was macht eigentlich Perry, während wir hier Sol – die heimische Sonne – und ihre besiedelten Planeten und Monde verteidigen? Perry ist dann mit weit universelleren Aufgaben beschäftigt. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass das Raum-Zeit-Kontinuum nicht den mehrdimensionalen Bach runtergeht. Er sichert die Naturgesetze des Einstein-Universums und rettet Milliarden von Völkern aus Millionen Galaxien davor, spurlos im Hyperraum zu verwehen. Meistens mit Erfolg.
Mit Hilfe einer Zeitreise startet er das vorwitzige Unternehmen, die Negasphäre zu verhindern, die von den Chaosmächten in der Lokalen Gruppe implantiert werden soll. „Ich sehe zerschundene Raumzeit, höre das Heulen der Schwerkraft und den Schrei der Materie, die niederfährt in die Kluft.“ (Wim Vandemaan, Heft 2490, S. 10)
Der Raum selbst ist krank, und ein Geradeaus-Fliegen unmöglich. „Alles hier verschwimmt, als ob das Licht auf irrwitzigen Umwegen zu uns kommen müsste“ … „als schlüge ihm eine Front aus gebeugtem Licht in irren Wellen entgegen.“ (Horst Hoffmann, Heft 2428, S. 9)
Chaotarchen und Kosmokraten liegen seit Jahrmilliarden im Clinch. Perry und die Seinen agieren dazwischen. Letztlich geht es bei dem Dauerkampf nicht um „Gut“ gegen „Böse“, da sowohl Ordnung als auch Chaos in ihrer Radikalität „das Leben an sich“ gefährden. „Savoire wunderte sich wieder einmal, wie wenig sich Chaos und Ordnung im Prinzip voneinander unterschieden.“ (Uwe Anton, Heft 2480, S. 48)
Natürlich findet auch der größte aller Romanzyklen seine Kritiker, die ganz unverschämt die Frage aufwerfen: Ist das überhaupt Literatur? Na, sicher! Was denn sonst! Um den literarischen Status der Serie zu legitimieren, bedarf es nicht erst des Hinweises, dass auch namhafte, in der „Hochliteratur“ verankerte Autoren wie Andreas Eschbach oder Gisbert Haefs gelegentlich am großen Perry-Rhodan-Epos mitschreiben.
Paraflimmern, Schwingenraumer, Schwerkraftverwirbelungen, Dimensionenschwund, Karrenschleicher, psychoparasitärer Befall, Gravitationsweiden, Proto-Negasphäre, Matten-Willy, Energietaucher, Metaläufer, Gestaltwandler, Mosaikintelligenz, Schwebepolster, Drangwäsche, mentales Wasserzeichen, Vital-Signaturen, donnerblau, pseudomaterielle Objekte oder ein Leichengleiter, der als futuristischer Leichenwagen unseren Weg kreuzt, sind nur einige der allpräsenten Wortneuschöpfungen aus der Serie. Viele Begriffe erklären sich wie Formenergie anschaulich auch ohne Translatoren. Bei der Terminalen Kolonne TRAITOR, bei der Frequenz-Monarchie oder den Qualnäer Keretzen leiten wir schon aus dem Klang ihres Namens ab, dass sie unbequeme Gegner sein werden. Dürfen wir hingegen – mag man sich fragen – „Halbspur-Changeur“ als Schimpfwort benutzen, ohne uns in unserem Standarduniversum eine Beleidigungsklage einzuhandeln?
Viele Völker des Universums beherrschen die galaktische Verkehrssprache, das Interkosmo. Manche Wesen aber kommunizieren auf keine uns bekannte Weise: „Millionen und Abermillionen Nanosekunden später vernahm es einen fernen Widerhall, zart und schwebend. Es setzte sich auf seine Spur. Oh, sie hatten sich bestens verkappt, diese Signale. Sie kamen in den irrwitzigsten Tarnungen daher. Sie wisperten wie Quantenschaum, sie lärmten wie Jetströme, sie waren solarer Wind und das Rieseln aus feinsten Rissen in den Membranen zum Dakkarraum, und sie waren alles dies zugleich.“ (Wim Vandemaan, Heft 2433, S. 48).
Immer wieder geraten Akteure in andere Dimensionen, Zeitebenen, parallele Welten: „Die stoffliche Welt war, von diesem versetzten Energieniveau aus erfahren, nur ein schemenhaftes Lichterspiel. Umrisse verschwammen, alles war wie von einer überschäumenden Glorie umgeben. Dennoch fiel es ihm nicht schwer, sich hinter dem Schleier zu orientieren. Er war es gewohnt.“ (Wim Vandemaan, Heft 2433, S. 49)
Nicht zuletzt sind die Hefte ein wöchentlicher Seelentrip oder bewirken zumindest „eine leichte, metareale Touchierung“ (2533, S. 39). Um es mit dem Weisen Davin Abangy zu sagen: „Hier erfahren Interessierte, was sie sind und wer sie sind. Es mag ein paar Jahrhunderte intensivster Verinnerlichung dauern – aber es funktioniert.“ (Michael Marcus Thurner, Heft 2435, S. 47)
Der Aufbruch mancher Sternenreisender mündet jedoch oft auch in der Feststellung, wie universal manche terranischen Eigenarten sind. Alte deutsche Spruchweisheiten findet man Millionen von Lichtjahren entfernt – den kulturellen oder physiognomischen Besonderheiten der Fremden angepasst – wieder. Es werden in Variationen und mehr Dimensionen überall die gleichen Spiele gespielt, und viele Völker haben ihre Schlagerbarden oder holografierten Fernsehtanten, die einen irgendwie an ein irdisches Vorbild erinnern. Auch Chefs, Enthüllungsjournalisten, Sektenführer und Militärs ähneln sich in allen Sternhaufen und zu allen Zeiten. Und wenn sich die Abgeordneten der galaktischen Völker zu einem Kongress versammeln, könnte eine EU-Ratssitzung als Vorbild gedient haben.