Serientäter in Bochum – der neue Krimi von Theo Pointner
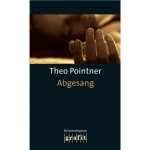 Vier Jahre haben treue Leser warten müssen, bis Kommissarin Katharina Thalbach und ihre Kollegen von der Bochumer Kripo zum zehnten Mal ermitteln. Band 9 „Highscore“ endete mit einem Cliffhanger erster Güte. Die Frage, ob Ex-Mann und Sohn der smarten Kommissarin ein Attentat überlebt haben, blieb offen.
Vier Jahre haben treue Leser warten müssen, bis Kommissarin Katharina Thalbach und ihre Kollegen von der Bochumer Kripo zum zehnten Mal ermitteln. Band 9 „Highscore“ endete mit einem Cliffhanger erster Güte. Die Frage, ob Ex-Mann und Sohn der smarten Kommissarin ein Attentat überlebt haben, blieb offen.
Autor Theo Pointner hatte ob dieser langen Wartezeit ein Einsehen und spannt seine Leser in Band 10 „Abgesang“ nicht allzu lange auf die Folter. Schon auf den ersten Seiten wird die drängende offene Frage aufgelöst. Doch viel Zeit haben Katharina Thalbach, ihr – zur Überraschung aller – neuer Chef Berthold Hofmann und das Team nicht, sich um ihr Privatleben zu kümmern. Eine widerwärtige Mordserie hält Bochum in Atem. Ein Psychopath von äußerst brutalen Ausmaßen mordet erst das Kind und dann die Mutter. Ein 15jähriges Mädchen wird erstochen, bei der Mutter fand eine fast schon rituelle Tötung statt.
Ausgerechnet die Thalbach, sonst bei jeder Ermittlung ruhe- und rastlos getrieben, engagiert sich diesmal nur halbherzig. Zu sehr nehmen drängende Fragen ihres Privatlebens sie in Beschlag und lassen sie fast schon verzweifeln an der von ihr gewählten Art der Lebensführung. Als dann ein fünfjähriger Junge verschwindet, muss alles Private zurückstehen, denn nun ist klar: Die Bochumer Kripo hat es mit einem Serientäter zu tun und ihr läuft die Zeit davon.
„Abgesang“ ist ein handwerklich gut gemachter Krimi. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Es steht Krimi drauf, es ist Krimi drin und keine Mogelpackung. Solide und ehrlich, so wie man es auch den Menschen im Ruhrgebiet nachsagt. Glücklicherweise gehört „Abgesang“ jedoch nicht zu den Ruhrpott-Krimis, die nur vom Lokalkolorit leben. Für den heimischen Leser ist es sicher schön, ihm wohlbekannte Schauplätze liebevoll gezeichnet im Roman beschrieben zu bekommen. Die Handlung könnte jedoch auch überall sonst in Deutschland angesiedelt sein, was Pointner und den Krimiprofis vom Dortmunder Grafit Verlag wünschenswerterweise eine Leserschaft über die Grenzen des Reviers hinaus erschließen könnte.
Pointner hält im Roman die Spannung und ein gutes sprachliches Niveau. Gelegentlich fällt ihm das Umgangssprachliche schwer, aber in der Regel schaut er sehr genau hin. Seine Figuren – ob Bildungsbürger oder angelernte Hilfskraft – überzeugen. Die privaten Probleme, mit denen die sympathische Kommissarin hadert, sind stets nachvollziehbar und mit ihrem drohendem Burnout auch auf der Höhe der Zeit. Dem Aufbau des Plots tut es gut, den Mörder selbst zwischendurch immer wieder als Ich-Erzähler zu Wort kommen zu lassen, ohne überflüssige Hinweise auf seine Identität zu geben.. Die verquere Gedankenwelt des Täters wird dadurch ein wenig nachvollziehbarer für den Leser. Dessen Identität kommt die Thalbach noch vor dem ausgesprochen blutigen Finale – welches die Meßlatte von Slaughters Belladonna locker überspringt – auf die Schliche. Nach der Entlarvung ist die Versuchung groß, zurückzublättern, um nachzusehen, an welcher Stelle genau er sich schon verraten hat.
Der gebürtige Bochumer Theo Pointner ist studierter Betriebswissenschaftler und als solcher Leiter des Medizin-Controllings eines Krankenhauses im Ruhrgebiet. Als Autor ist auch er ein Serientäter. Mit nunmehr zehn Bänden um Katharina Thalbach hat er sich eine treue Fangemeinde erschrieben. So nett er allerdings eingangs zu seinen Lesern war, den offenen Plot aus dem Vorgänger-Buch aufzulösen, so sehr wird er die Fans von Katharina Thalbach mit dem wiederum offenen Ende von „Abgesang“ verstören. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Titel des Buches nicht schon das Programm für die Zukunft ist.
Theo Pointner: „Abgesang“. Kriminalroman, Grafit-Verlag, Dortmund, 313 Seiten, 9,99 Euro.
